Die globale Automobilindustrie steht an einem Wendepunkt. Wie die neue Ausgabe des Automotive Disruption Radar (ADR 14) von der Unternehmensberatung Roland Berger zeigt, übernimmt China zunehmend die technologische Führung in der Branche und belegt damit die Spitzenposition unter den betrachteten Ländern. Dagegen geraten europäische Länder und vor allem die USA unter Druck.
Deutschland hält sich mit Platz 7 in der Führungsgruppe, vor allem aufgrund von Fortschritten beim autonomen Fahren, stabiler Patentanmeldungen sowie seiner exportorientierten Hersteller.
Die Studie, für die die Berater 22 Automobilnationen nach 26 Indikatoren analysiert und zudem über 22.000 Autobesitzer befragt haben, zeigt auch, dass sich die regionalen Ökosysteme zunehmend auseinanderentwickeln: Die Unterschiede zwischen den Märkten, etwa bei technologischen Standards, Regulierung oder auch Kundenpräferenzen, nehmen rasant zu – vor allem zwischen China und dem Rest der Welt. Auch wenn eine vollständige Entkopplung unwahrscheinlich sei, zwinge diese Entwicklung die Automobilhersteller dazu, je nach Zielregion unterschiedliche Herangehensweisen zu nutzen.
„Die Transformation der Automobilindustrie ist in vollem Gang, aber sie läuft nicht weltweit im Gleichschritt“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. „China legt mit hohem Tempo vor und dominiert inzwischen alle Schlüsselbereiche der Automobilindustrie – vom Marktanteil der Elektroautos über die Ladeinfrastruktur bis hin zu KI-basierten Fahrerassistenzsystemen. Zudem entwickeln chinesische Hersteller neue Fahrzeuge innerhalb von 24 bis 40 Monaten, während die Europäer dafür 48 bis 60 Monate benötigen. Daher fällt Europa zurück.“
Marktanteil von E-Autos in China mehr als doppelt so hoch wie in Europa
China setzt sich daher im Ranking des ADR 14 deutlich von seinen Verfolgern ab: Vor allem mit Bestwerten bei den Indikatoren Technologie und Infrastruktur unterstreicht das Land laut den Beratern seine führende Position in den entscheidenden Feldern Elektromobilität und Autonomes Fahren.
Dazu kommen ein ausgeprägtes Interesse der Verbraucher an den neuesten Elektrofahrzeugen – 95 Prozent planen beim nächsten Autokauf einen Elektroantrieb – sowie Hersteller, die das passende Portfolio und eine gut entwickelte Ladeinfrastruktur anbieten. Dementsprechend steigt der Elektroanteil an den Neuwagenverkäufen in China seit der vorhergehenden Ausgabe des ADR von 22 auf 25 Prozent, während er in Europa bei 12 Prozent stagniert. So sinkt etwa in Deutschland der Anteil derer, die sich vorstellen können, als nächstes ein E-Auto zu kaufen, von 55 Prozent im Jahr 2021 (ADR 9) auf 45 Prozent im aktuellen ADR.
Die Spitzengruppe hinter China besteht aus Südkorea, den Niederlanden sowie Norwegen, Schweden und Singapur. Deutschland folgt knapp dahinter auf Platz 7 – es punktet trotz der Rückschritte bei den E-Auto-Verkaufszahlen mit effizienten und schnellen Zulassungsverfahren für autonome Fahrfunktionen, einer weiterhin hohen Patentaktivität und global exportstarken Herstellern. Allerdings sinkt in der Bundesrepublik auch das Interesse an „Shared Mobility“ und anderen innovativen Konzepten, zum Beispiel digitalen Angeboten für den Autokauf; sowohl Anbieter als auch Kunden sind hier nach wie vor sehr zurückhaltend.
Der wichtige Automarkt USA rutscht auf Platz 14 ab, unter anderem wegen rückläufigen Interesses der Verbraucher an neuen Technologien und Konzepten wie Shared Mobility. Dazu kommen eine zunehmende Isolierung durch politische Unsicherheiten sowie eine abnehmende Innovationsdynamik im Mobilitätsbereich. Zudem geht in den USA der Trend zurück zum Privatfahrzeug – eine Tendenz, die es auch in anderen reifen Märkten wie Deutschland, Japan oder China gibt.
Regionale Differenzierung als Herausforderung für die Autohersteller
Im aktuellen ADR legen die Roland-Berger-Experten ein besonderes Augenmerk auf die wachsende Divergenz zwischen den Automärkten weltweit: „Vor allem bei Software, Standards und Entwicklungsgeschwindigkeit, aber auch bei den Erwartungen der Kunden beobachten wir, dass die verschiedenen Regionen zunehmend unterschiedliche Wege einschlagen“, sagt Stefan Riederle, Partner bei Roland Berger.
Auch wenn Riederle eine vollständige Entkopplung der Fahrzeugarchitekturen schon aus wirtschaftlichen Gründen für sehr unwahrscheinlich hält, empfiehlt er den Autoherstellern, die Entwicklung genau zu verfolgen und in ihren Planungen zu berücksichtigen. „Es wird zur Überlebensfrage, strategische Allianzen, Softwarekompetenz und die Anpassung an die Unterschiede der Märkte miteinander zu verbinden. Autohersteller müssen künftig zumindest mit zwei Systemen arbeiten: einem für China, einem für den Rest der Welt.“
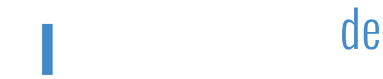

Sebastian meint
Die Niederlande/Singapur/Korea leben vom globalen Handel. Norwegen und Schweden vom Verkauf von Erdöl. Also genau gesagt, sind die Maden die sich im Speck suhlen.
Mich wundert eigentlich das Daten die jedem ****** 24h zugänglich sind, immer wieder zweckentfremdet werden.
hu.ms meint
„vor allem geraten die USA unter Druck“
Bestätigt meine meinung zum grössten US-BEV-hersteller: keine technischen verbesserungen bei
akkugrösse, ladegeschwindigkeit assistenzsysteme auf der strasse und neue modelle.
IDFan meint
Durchschaubar. Sie wollen die Deutschen beraten – von China lernen. Das brauchen die Deutschen aber nicht. Sie haben technologisch lange übernommen.
M. meint
Technologisch spielen die Deutschen schon mit, aber preislich noch nicht.
Aber da sind mehr Akteure gefragt als die Autohersteller, auch wenn die mehr machen könnten, z.B bei der Versorgung mit günstiger Energie. Tesla baut PV auf die Fabrikdächer, BMW betreibt in Leibzig (?) ein Werk teilweise mit eigenen Windkraftanlagen. Das ist gut, kann aber noch besser werden. Andere haben mehr noch Hausaufgaben zu machen.
Alles alleine lösen können sie aber nicht. Gegen die Schere bei den Arbeitskosten ist außer „Ungarn“ (o.ä.) kaum ein Kraut gewachsen. Da muss man aufhören, ständiger Inflation mit Lohnsteigerungen begegnen zu wollen – damit heizt man die Inflation nur noch mehr an und vergrößert den Abstand zu anderen Ländern, statt ihn zu verkleinern, was das eigentliche Ziel sein muss.
Jörg2 meint
M
Ich bin da sehr bei Dir.
Möchte aber zu bedenken geben:
„Technologie“ ist nicht nur das, was wir am Produkt sehen und hier regelmäßig an den Themen „Zellchemie“, „Ladegeschwindigkeit“, „ADAS“ diskutiert wird. „Technologie“ ist auch das, was in der Produktion stattfindet, da wo ein Großteil der Kosten entstehen.
Und da muss es dann auch nicht immer Rakenwissenschaft sein. Das selbständige Fahren vom Band zum werkseigenen Ladeplatz (gibt es bei mehreren Herstellern) und dann zum Auslieferungspuffer scheint Kinkerlitzchen zu sein, spart aber wohl Personal. Das automatisierte Durchschalten der Lichtanlage und automatisiertes Erkennen, ob alles funktioniert – auch keine Rakenwissenschaft, spart aber Personal…
Future meint
Beratungsresistenz ist ja meistens der Anfang vom Ende. In den Führungsebenen ist es ähnlich. Oft werden die Berater erst nach einem Führungswechsel hinzugezogen, weil die Lage dann nicht mehr beschönigt werden muss. Vernünftige Unternehmen setzen auf langfristige kontinuierliche Beraterleistungen, um zu Entscheidungen zu kommen. In den unteren Etagen sind die Berater wohl weniger willkommen, weil es ja auch regelmäßig um Kosteneinsparungen geht. Jetzt ist es ja auch wieder so – nicht nur bei VW. Die Studie von Roland Berger ist natürlich auch PR in eigener Sache – aber darum geht es bej jeder hier veröffentlichen Pressemitteilung.
Till meint
Die Deutschen haben in der Tat technologisch übernommen, allerdings nur sehr kurz. Denn wo kein Bedarf ist, da wird auch nicht weiter geforscht. Aktuell haben Söder, Merz, Källenius, Zipse, u.v.m. auf der IAA den Bedarf für die E-Mobilität auf den St. Nimmerleinstag verschoben, wegen der „Technologieoffenheit“ und weil „die Deutschen noch nicht so weit sind“. Ja! Die Welt wird auf uns warten.