Der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Gewerkschaft IG Metall haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. „Jetzt Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sichern“, lautet ihr Aufruf.
Die Situation in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie spitze sich weiter zu. Der Zustand der Unternehmen sei zwar unterschiedlich, für die Industrie insgesamt aber sei die Lage bedrohlich. Die Herausforderungen durch den zunehmenden internationalen Wettbewerb, hohe Kosten am Standort Deutschland, Zoll- und Handelskonflikte sowie ein immer noch schwächelndes europäisches Marktumfeld nähmen zu.
In China müssten deutsche Hersteller um ihre Marktanteile kämpfen, die USA setzten ihre Handels- und Industrieinteressen entschieden durch und der europäische Markt komme weiterhin nicht an die Absatzzahlen von 2019 heran, heißt es in dem Papier. „In der Folge sind deutsche Werke nicht ausgelastet. Aktuell gehen jeden Monat in Deutschland Arbeitsplätze in der Automobilindustrie verloren, von Juni 2024 bis Juni 2025 waren es über 50.000.“
Um die Frage zu beantworten, wie Automobilarbeitsplätze in Europa und insbesondere in Deutschland gesichert werden können, seien die Antworten politisch umstritten. VDA und IG Metall teilten dabei jedoch einige grundlegende Einschätzungen: „Es ist notwendig, die Nachfrage auf dem europäischen Markt zu stärken, den europäischen Wertschöpfungsanteil der hier produzierten Fahrzeuge hochzuhalten und bei neuen Technologien zu steigern sowie die Entwicklungszyklen in unserer Industrie zu beschleunigen.“ Energiekosten müssten gesenkt werden und es brauche konsequenten Bürokratieabbau – darauf sei insbesondere der industrielle Mittelstand angewiesen.
Einigkeit besteht auch über wesentliche Defizite in den politischen Rahmenbedingungen. IG Metall und VDA fordern die Politik auf nationaler und europäischer Ebene auf, rasch die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um die Lage zu stabilisieren und der deutschen Automobilindustrie zu ermöglichen, ihren eingeschlagenen Weg zu klimaneutraler Mobilität mit guter Beschäftigung in Deutschland fortzusetzen. Dies betrifft hauptsächlich zwei Punkte: Die Politik müsse endlich die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität in ganz Europa schnell und umfassend verbessern. Und sie müsse die CO₂-Regulierungen flexibilisieren.
„Elektromobilität europaweit schnell und entschlossen unterstützen“
Die Automobilindustrie investiere hohe Summen in den Hauptpfad der Elektromobilität zur Dekarbonisierung des Verkehrs, wird betont. Bis 2029 werde die Branche weltweit mehr als 320 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren sowie weitere 220 Milliarden Euro in den Auf- und Umbau von Werken. Und im Jahr 2030 werde sie etwa 200 batterieelektrische Modelle auf dem Markt haben.
„Dies unterstreicht den konsequenten Kurs auf die Elektromobilität und ist entscheidend, um die Zukunft der Automobilproduktion und der Beschäftigung in Deutschland zu sichern“, heißt es. „Um diesen zentralen Technologiepfad aber erfolgreich gehen zu können, brauchen Hersteller, Zulieferer und die Beschäftigten der Branche mehr Unterstützung durch die Politik. Es bedarf einer entschlossenen industriepolitischen Initiative zur Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für den Hochlauf der Elektromobilität und zur Verbesserung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Nur dann kann dieser Wandel für die hiesigen Standorte auch zum Erfolg werden und Wachstum und Beschäftigung sichern.“
Dazu gehörten die folgenden Handlungsbedarfe und Maßnahmen:
- Der Markthochlauf elektrischer Fahrzeuge müsse weiter unterstützt werden, durch steuerliche Vergünstigungen für private wie gewerbliche Neu- und Gebrauchtwagen, bis hin zur Unterstützung beim Zugang zur Elektromobilität für die ganze Breite der Gesellschaft. Darüber hinaus müsse die im Koalitionsvertrag angekündigte Verlängerung der Kfz-Steuer-Befreiung für Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 „umgehend“ umgesetzt werden. Da die derzeitige Regelung Ende 2025 ausläuft, bräuchten Verbraucher und Unternehmen dringend Planungssicherheit. Entscheidend sei, dass eine unmittelbare Anschlussregelung ab dem 1. Januar 2026 gewährleistet wird, um den Hochlauf der Elektromobilität nachhaltig zu unterstützen.
- Der Ausbau der Ladeinfrastrukturen für Pkw und Lkw sei europaweit deutlich zu langsam und in Europa nicht bedarfsgerecht verteilt. Hier müsse vor allem die europäische Regulierung einen Rahmen bieten, um den Ladeinfrastrukturausbau inklusive der begleitenden Stromnetze massiv zu beschleunigen.
- Ladestrom sei in Deutschland zu teuer, hier müssten durch Senkung von Steuern und Abgaben sowie „kluge Regulierung für mehr Wettbewerb an den Ladepunkten“ die Preise sinken, vor allem für das Ad-Hoc-Laden. Ebenso sollte die Transparenz des Strompreises an der Ladesäule verbessert werden. Attraktive Durchleitungsmodelle seien notwendig, um den Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur finanziell und organisatorisch interessant zu machen.
- Dringender Handlungsbedarf bestehe beim bidirektionalen Laden. Die erfolgreiche Markteinführung des bidirektionalen Ladens setze einen EU-weit harmonisierten regulatorischen Rahmen und den konsequenten Abbau von Doppelbelastungen bei Stromnebenkosten voraus.
- Von zentraler Bedeutung sei der Aufbau einer resilienten und wettbewerbsfähigen Batteriewertschöpfungskette in Deutschland und Europa, um die systemische Abhängigkeit von asiatischen Lieferanten zu reduzieren. Dazu bedarf es einer gezielten Unterstützung der relevanten Teile der Batteriewertschöpfungskette, insbesondere der Batteriezellfertigung, mit dem Ziel einer schnellen Hochskalierung der Produktionskapazitäten.
- Dazu sei eine Diversifizierung der Bezugsquellen insbesondere der Rohstoffversorgung durch strategische Handelspartnerschaften, Erschließung europäischer Ressourcen und den schnellen Aufbau von Recycling-Kapazitäten notwendig. Entscheidend seien auch hier dauerhaft wettbewerbsfähige Standortfaktoren. Europas Automobilproduktion muss diesbezüglich resilienter werden.
- Um die europäischen und deutschen Wertschöpfungsanteile der hier produzierten und verkauften Fahrzeuge zu schützen und zu steigern, würden VDA und IG Metall über wirksame Konzepte dafür beraten.
- Unternehmen aus der Zuliefererbranche müssten in dieser schwierigen Umbauphase bei Liquidität und Eigenkapital für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unterstützt werden.
- Mit der Elektrifizierung gehe auch die Digitalisierung des Automobils einher. Die Politik sollte den regulatorischen Rahmen schaffen, sodass die Industrie die Digitalisierung mit Entschiedenheit vorantreiben kann, um Innovationen und Wertschöpfung in Deutschland zu realisieren. Dabei sollte eine gezielte Förderung sowie Industriekooperationen in den Technologiebereichen Software, Halbleiter und autonomes Fahren ermöglicht und begleitet werden. Auch im „Software-Defined-Vehicle“ würden große Potenziale für künftige Beschäftigung liegen.
- Auch für die schweren Nutzfahrzeuge müssten die Bedingungen für den Hochlauf des Marktes für klimafreundliche Fahrzeuge deutlich verbessert werden. Das betreffe unter anderem die Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw mitsamt der Priorisierung der Netzanschlüsse, der Netzkapazitäten, die H₂-Tankinfrastruktur für das Segment der Langstrecken-Lkw mit H₂-Brennstoffzelle oder Wasserstoffmotor und die Förderung des Depotladens für KMU der Logistikbranche. Die Review des Regulierungsrahmens für schwere Nutzfahrzeuge sollte vorgezogen und umgehend durchgeführt werden.
„Die Elektromobilität bleibt der zentrale und richtige Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung der deutschen Automobilindustrie und ihrer Standorte in der Zukunft zu sichern“, unterstreichen VDA und IG Metall. „Die Automobilindustrie zeigt ihren Willen zum Erfolg auch durch die Vielzahl der aktuell auf der IAA Mobility gezeigten neuen BEV-Modelle. Gleichzeitig müssen wir weitere technologische Lösungen ermöglichen und nutzen.“
„Flexibilisierungen in der Regulierung schaffen“
„IG Metall und VDA haben seit der Verabschiedung des aktuell gültigen Regulierungsrahmens darauf hingewiesen, dass die Ziele sehr ambitioniert sind und nur bei rechtzeitiger Schaffung der Rahmenbedingungen erreicht werden können“, heißt es weiter. „Heute müssen wir leider sagen: Das ist nicht in ausreichendem Maße geschehen. Der Hochlauf der Elektromobilität bei Pkw, Vans und schweren Nutzfahrzeugen bleibt deutlich hinter den Erwartungen vor wenigen Jahren zurück, als die Ziele im Rahmen einer Revision nochmals deutlich verschärft wurden.“
Der Markt für batterieelektrische Fahrzeuge wachse zu langsam und wirksame Maßnahmen zu Steigerung der Nachfrage und Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen fehlten. Hinzu komme, dass es innerhalb Europas sehr große Unterschiede gebe. Die Flottenregulierung für die Hersteller hingegen hätten für Europa nur einen einzigen Zielwert, das heißt, Defizite in einem Mitgliedstaat müssten durch Übererfüllung in anderen Mitgliedstaaten kompensiert werden. Vor diesem Hintergrund sei das Ziel für 2035 ohne kurzfristige Korrekturen nicht mehr erreichbar.
„Wir begrüßen, dass im Rahmen des anstehenden Strategiedialogs Maßnahmen zur Steigerung der Nachfrage diskutiert werden sollen. Allerdings ist die Ambition bei der Schaffung der oben aufgeführten Rahmenbedingungen nicht ausreichend und muss dringend mit der Flottenregulierung synchronisiert werden“, so VDA und IG Metall in ihrer Erklärung. „Doch auch bei einem größeren Erfolg des Hochlaufs batterieelektrischer Fahrzeuge bis 2035 ist absehbar, dass in mittlerweile nur noch neun Jahren die Bedingungen für eine Umstellung auf 100 Prozent rein batterieelektrische Fahrzeuge auf dem europäischen Markt für neue Fahrzeuge nicht gegeben sein werden.“
Auch die europäische Resilienz bei Rohstoffen und Batterieversorgung sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Batterie gegenüber asiatischen Konkurrenzprodukten werde noch nicht vorhanden sein. Bei allen Transformationsanstrengungen werde eine signifikante Anzahl von Arbeitsplätzen weiter an bisherigen Antriebstechnologien und deren Wertschöpfungsketten hängen.
„Pragmatischer Umgang mit Hybridtechnologien und erneuerbaren Kraftstoffen“
„Wir brauchen daher einen pragmatischen Umgang mit Hybridtechnologien und erneuerbaren Kraftstoffen. So könnten nach unterschiedlichen Studien europaweit bis zu 200.000 Arbeitsplätze gesichert werden“, heißt es.
Plug-In-Hybride (PHEV) und Elektrofahrzeuge mit Range Extender (EREV) könnten auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität eine sinnvolle Rolle spielen, erklären VDA und IG Metall. „Diese Technologien können in der aktuellen Transformation einen stabilisierenden Effekt auf die bisherige Wertschöpfung und damit auch auf die Beschäftigung bei vielen Unternehmen der Branche haben. Diese Unternehmen brauchen jetzt schnell Sicherheit über die zukünftigen Rahmenbedingungen ihrer Geschäfte.“
Es brauche außerdem einen anderen Umgang mit erneuerbaren Kraftstoffen im Zusammenhang mit elektrifizierten verbrennungsmotorischen Antrieben. Die EU-Kommission sollte ihren Vorschlag „für die nach 2035 erfolgende Zulassung von Fahrzeugen, die ausschließlich mit CO₂-neutralen Kraftstoffen betrieben werden“ vorlegen, wie bereits mehrfach zugesagt. Schnelle Anpassungen seien hier nötig, damit für Investoren und Unternehmen Planungssicherheit entsteht und ein Business-Case dieser Technik dann neu verlässlich bewertet werden kann.
„Beschäftigung fördern“
Diese Maßnahmen würden wesentlich zu einer Stabilisierung des Fahrzeugmarktes und zu positiven Beschäftigungseffekten beitragen, erklären die Lobbyisten. Weitere Wachstumspotenziale lägen in der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, Investitionsattraktivität und Technologieführerschaft in den Zukunftstechnologiefeldern der Elektromobilität und Digitalisierung.
Mit Blick auf die zunehmende handels- und geopolitische Volatilität in der Welt trage ein breiterer technologischer Ansatz zu einer stabileren Transformation der Automobilindustrie bei. Dies sichere den Zugang zu globalen Märkten und schaffe Perspektiven für die Beschäftigten und für die betroffenen Standorte der Unternehmen.
Abschließend heißt es in der Erklärung: „IG Metall und VDA setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die digitale und klimaneutrale Transformation der deutschen Automobilindustrie gelingt und dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und die gute Beschäftigung am Standort Deutschland dabei gewahrt bleiben.“
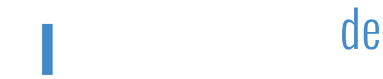

Thrawn meint
„…In China müssten deutsche Hersteller um ihre Marktanteile kämpfen, die USA setzten ihre Handels- und Industrieinteressen entschieden durch und der europäische Markt komme weiterhin nicht an die Absatzzahlen von 2019 heran,…“
Aha! Und das alles, OBWOHL die Hersteller ja immer noch massenhaft Verbrenner im Programm haben.
Was also soll die Aufhebung eines Gesetzes bringen, das sowieso erst in 10 Jahren greift? Kann mir das mal jemand erklären?
Hier wird doch nur ein Schuldiger für das eigene Versagen gesucht. Die falschen Autos zur falschen Zeit zum falschen Preis. Deswegen Verkauft sich der Kram nicht. Ob mit oder ohne Verbrenner spielt keine Rolle.
M. meint
„Beschäftigung fördern“
Ja, IGM. Dann muss man aber auch mal über den eigenen Tellerrand schauen und sich ansehen, mit wem man im Wettbewerb liegt.
Und dann sieht man, dass eine 32-Stundenwoche mit vollem Lohnausgleich ebensowenig funktioniert wie eine 35 Stundenwoche und ständige Lohnsteigerungen.
Die bringen auch nichts, weil jede Lohnsteuerung in einem so großen Bereich Preissteigerungen nach sich zieht, also die Mieten und Brotpreise steigen, weil die Menschen es sich ja leisten können, und die höheren Produktionskosten für die Autos muss der Hersteller auch einpreisen. Das ist eine Spirale, und das Einzige, das passiert: früherer Ersparnisse werden entwertet.
Also mal die Kirche im Dorf lassen, sonst wird halt in Ungarn, Spanien oder China gebaut.
Das habt ihr selbst zu verantworten.
(und das sage ich als AN)
Baumgartner meint
@M: Mal eine andere Perspektive: Lohnzurückhaltung ist genau das Problem warum wir so eine schwache Binnennachfrage haben in Deutschland. Deshalb sind wir auch so abhängig vom Export. Unsere Produkte sind für die meisten Deutschen einfach zu teuer, weil sie nicht genug verdienen.
Mit Verzicht auf Lohnerhöhungen werden wir uns sicher nicht wieder wettbewerbsfähig schrumpfen können. Dafür ist der Abstand zu den „best cost countrys“, selbst in der EU viel zu hoch. Und komplette Verarmung kann sich doch keiner wünschen bei gleichbleibenden Lebenshaltungskosten. Wir können eigentlich nur mit mehr Produktivität punkten. Hohe Löhne sind eine Produktivitätspeitsche. Dafür bräuchten wir aber auch Firmen die einen relevanten Marktanteil an Zukunftsbranchen haben. Da sind wir leider nicht so gut. Wir haben hier leider viel old economy. Und falls du meinst den Gewerkschaften geht es prächtig im aktuellen System: weit gefehlt. Schau mal an wie stark in den letzten 30 Jahren die Tarifbindung zurückgegangen ist. Die Firmen versuchen es zu umgehen wo immer es geht.