Eine Analyse der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) zeigt, dass viele Hausbesitzer auf dem Land grundsätzlich offen für Elektromobilität sind – insbesondere dann, wenn sie zu Hause laden können. Im Interview mit Springer Professional erläutert IKND-Geschäftsführerin Carolin Friedemann die Hemmnisse und Potenziale beim Umstieg auf E-Autos.
Der Umfrage zufolge sehen 65 Prozent der ländlichen Hausbesitzer die hohen Anschaffungskosten als größtes Hindernis. Besonders Menschen ohne eigene Photovoltaikanlage empfinden E-Autos oft als teuer, obwohl das Interesse auch bei Haushalten mit mittlerem oder kleinem Einkommen hoch ist. Eine laut Friedemann wichtige Frage: „Kann ich zu Hause laden und Strom selbst erzeugen?“
Für viele Käufer sei genau das – das Laden zu Hause – ausschlaggebend gewesen. Deshalb müsse die Ladeinfrastruktur dort ausgebaut werden, wo das Auto ohnehin oft steht: zu Hause, am Arbeitsplatz oder an Park-and-Ride-Flächen. In Städten fehle es teils noch an Ladesäulen in ganzen Vierteln, hier seien Kommunen in der Verantwortung.
Auch Unternehmen könnten mehr beitragen, etwa durch photovoltaiküberdachte Parkflächen mit Lademöglichkeiten. Steuerliche Erleichterungen seien dabei ein wichtiger Hebel. Friedemann fordert, dass der Staat Anreize schafft, damit Arbeitgeber selbst erzeugten Strom direkt vor Ort zum Laden bereitstellen.
„Förderprogramme müssen einfacher und gezielter werden“
Die Umfrage der IKND zeigt: Wer bereits ein E-Auto fährt, besitzt meist auch eine Photovoltaikanlage, eine Wallbox und häufig einen Stromspeicher. Dies zeigt laut Friedmann, dass hier noch viel Potenzial ungenutzt ist. Wichtig sei: „Förderprogramme müssen einfacher und gezielter werden. Gerade Menschen mit kleineren Einkommen nehmen sie oft nicht in Anspruch, weil sie zu kompliziert sind oder nicht gut kommuniziert werden. Da braucht es mehr Bürokratieabbau.“ Und auch die Händler sollten stärker darauf hinweisen: „Achtung, hier gibt’s Förderprogramme“. Es fehle oft an Bekanntheit.
Ein von der Bundesregierung angedachtes „Social Leasing“-Modell könnte nach Ansicht von Friedemann einkommensschwächeren Haushalten helfen. „Wichtig ist aber, dass es einfach zugänglich bleibt – ohne komplexe Nachweise oder lange Formulare.“ Es brauche dabei verlässliche und ausreichende Budgets – „nichts ist schlimmer, als wenn ein Programm nach drei Monaten gestoppt wird, weil das Geld alle ist“.
Beim Zusammenspiel von Photovoltaikanlage, Energiespeicher und digitalem Energiemanagement sieht Friedemann die größte technische Hürde beim Smart Meter. Deutschland liege hier im europäischen Vergleich weit hinten. Bidirektionales Laden und flexible Stromtarife erforderten jedoch genau diese Infrastruktur.
Auch die Energieversorger müssten aktiver werden. Flexible Tarife für Haushalte mit Smart Meter seien technisch möglich, aber oft unbekannt. Hier bestehe ebenfalls Aufklärungsbedarf.
Schließlich fordert Friedemann politische Planungssicherheit. Private Haushalte hätten dieselben Erwartungen wie Unternehmen: Investitionen müssten auf verlässlichen Rahmenbedingungen beruhen. „Ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität und zur Sektorkopplung wäre wichtig – und das über Legislaturperioden hinaus.“ Ein klares Zielbild und verlässliche Rahmenbedingungen machten am Ende den Unterschied.
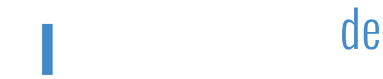

Ihre Meinung