Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat mit der Strategieberatung Roland Berger den „Battery Monitor 2024/2025“ veröffentlicht. Der Studie zufolge wird sich die weltweite Batterie-Nachfrage bis 2030 auf bis zu 4,6 Terawattstunden verdreifachen und von dort aus bis 2040 eine Verdopplung erfahren.
Der europäische Batteriemarkt sei derzeit vom Preiskampf asiatischer Hersteller geprägt: Lokale Überkapazitäten durch zu optimistische Bedarfsannahmen etwa aus China sorgen laut den Autoren für weltweit fallende Preise und setzen europäische Hersteller weiter unter Druck, die ohnehin mit höheren Produktionskosten und Unwägbarkeiten beim Hochlauf der Elektromobilität zu kämpfen hätten. Dem „Battery Monitor“ zufolge müssen neue Akteure in Europa hochwertige Batteriezellen künftig preiswerter produzieren, wobei Kooperationen mit asiatischen Wettbewerbern sich als sinnvoll erweisen könnten.
Drei Szenarien für die Entwicklung des Batteriebedarfs
„Trotz erheblicher Unsicherheiten wächst der globale Batteriemarkt weiter stark und bietet damit auch Chancen für europäische Hersteller, wenn sie sich auf Wettbewerbsvorteile durch Innovationen, hochwertige Prozesstechnologien und die Ökobilanz der Batterien fokussieren“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker. „2024 hat die Volatilität im Markt für Batteriezellen stark zugenommen“, resümiert Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. „Das liegt vor allem an Unsicherheiten in Bezug auf die Nachfrage, weil die Zahl der verkauften E-Autos langsamer steigt als erwartet und sowohl in den USA als auch in der EU ungewiss ist, wie es regulatorisch weitergeht.“
Die Studie präsentiert drei Prognosen für die Entwicklung des Bedarfs: Eine Positiv-Annahme, die ein schnelles Fortschreiten der Elektrifizierung annimmt, ein Basis-Szenario, das trotz eines vorübergehenden Rückgangs der E-Auto-Verkäufe die Erreichung der Emissionsziele in der EU und den USA voraussagt, und ein Negativ-Fall mit deutlichen Verzögerungen, etwa durch eine Verschiebung des „Verbrenner-Verbots“ in der EU.
Erst Überkapazitäten, dann Investitionszurückhaltung
Auf dem globalen Markt produziere China derzeit deutlich mehr Batterien als der eigene Markt nachfrage, wodurch die Überschüsse exportiert würden, so die Studienautoren. Das führe weltweit zu fallenden Preisen, die jedoch nicht so niedrig bleiben könnten, da schon jetzt einige der Zulieferer und Produzenten in China nicht mehr kostendeckend arbeiteten. Aktuell setze der Preisverfall aber vor allem europäische Hersteller unter Druck, die am Aufbau eigener Kapazitäten arbeiten und damit theoretisch mehr als den europäischen Bedarf decken könnten.
Laut dem „Battery Monitor“ werden sich indes nicht alle angekündigten Projekte realisieren lassen. Seien Unternehmen in der EU und den USA zuletzt vergeblich in Vorleistung gegangen, agierten sie bei ihren Investitionsplanungen nun äußerst vorsichtig, was wiederum das Risiko einer Unterversorgung berge. „Dieser Trend wird von Verzögerungen in der Industrialisierung und von fehlender ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich getrieben“, sagt Kampker. „Es ist unwahrscheinlich, dass europäische oder nordamerikanische Unternehmen bei gleichen Produkten und Technologien den chinesischen Kostenvorsprung und Rohstoffzugang jemals einholen können.“
Die europäischen Batteriehersteller setzten indes vor allem auf Nachhaltigkeit, um sich von ihren chinesischen und US-amerikanischen Wettbewerbern abzusetzen. Ziel sei es, die Emissionen bei der Herstellung von Batteriezellen auf bis zu 40 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde zu senken. Das entspreche etwa einem Drittel bis hin zur Hälfte des aktuellen CO2-Fußabdrucks von Batteriezellen. Darin liege ein potenzieller Wettbewerbsvorteil der Europäer, sagt PEM-Leitungsmitglied und Batterie-Experte Professor Heiner Heimes. „Zumal es unwahrscheinlich ist, dass europäische oder nordamerikanische Unternehmen bei gleichen Produkten und Technologien den chinesischen Kostenvorsprung und Rohstoffzugang jemals einholen können.“
Ein weiterer Ansatzpunkt für die Branche bestehe in realistischen Fortschritten bei der Zellchemie. „Wer seine Produktionspläne frühzeitig auf Innovationen wie neue, kostengünstige Batterietypen für kleine und Mittelklasse-Elektroautos ausrichtet, kann schneller in die Massenproduktion übergehen“, sagt Heimes.
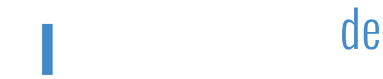

David meint
Wir können ja auch wieder mit der Solarzellenproduktion beginnen oder Reis anbauen. Vielleicht im Nahetal, da scheint es ja feucht zu sein. Oder in Grünheide, wo die Wasserrechte weitgehend ungenutzt bleiben.
Jeff Healey meint
(…) „Es ist unwahrscheinlich, dass europäische oder nordamerikanische Unternehmen bei gleichen Produkten und Technologien den chinesischen Kostenvorsprung und Rohstoffzugang jemals einholen können.“(…)
Dem stimme ich weitestgehend zu.
Wenn wir jedoch den Teilbereich „Rohstoffzugang“ gesondert betrachten, gäbe es zumindest für den stationären Bereich mittelfristig die Option auf Natrium-Ionen Technologie zu schwenken, deren Ausgangs-Stoffe für die Zellchemie auch in Europa fast unbegrenzt verfügbar sind.
Hier bietet sich eine Chance deutlich unabhängiger zu werden.
Der Kostenvorsprung der chinesischen Hersteller wäre durch einen höheren Grad an Automatisierung, europäische Innovationskraft, und das Bereitstellen besonders günstigen Strompreisen für die zukünftige europäische Batterieproduktion, annähernd auszugleichen.
Es ist lediglich eine Frage des politischen und gesellschaftlichen Willens.
Im Automotive Bereich laufen bereits viele Batterie-Kooperationen mit chinesischen Partnern an, die mittelfristig und langfristig eine ausreichend zufriedenstellende Versorgung und ein allgemein gutes Preisgefüge sichern sollten. Hier muss man sagen, machen europäische Alleingänge keinen Sinn mehr, da zu viel Zeit verloren wurde.