Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet einen Anstieg des Stromverbrauchs bis 2027 um durchschnittlich vier Prozent pro Jahr, angetrieben durch zunehmenden Verbrauch in der Industrie, bei Klimaanlagen, Elektrifizierung und Rechenzentren.
Die IEA prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage bis 2027 jedes Jahr um eine Menge zunehmen wird, die dem jährlichen Stromverbrauch Japans entspricht. Der Anstieg sei in erster Linie auf die stark wachsende Nutzung von Strom für die industrielle Produktion, die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen, die zunehmende Elektrifizierung, vor allem im Verkehrssektor, und den raschen Ausbau von Rechenzentren zurückzuführen.
Der größte Teil der zusätzlichen Nachfrage in den nächsten drei Jahren wird dem Bericht zufolge aus Schwellen- und Entwicklungsländern kommen, auf die 85 Prozent des Nachfragewachstums entfallen. Am deutlichsten ist der Trend in China, wo die Stromnachfrage seit 2020 schneller wächst als die Gesamtwirtschaft.
Der Stromverbrauch der Volksrepublik stieg laut der IEA im Jahr 2024 um 7 Prozent und wird bis 2027 voraussichtlich um durchschnittlich rund 6 Prozent zunehmen. Das Nachfragewachstum in China sei zum Teil durch den Industriesektor angeheizt worden, wo neben den traditionellen energieintensiven Sektoren die rasch expandierende stromintensive Herstellung von Solarmodulen, Batterien, Elektrofahrzeugen und zugehörigen Materialien eine wichtige Rolle spielte. Klimaanlagen, die Einführung von E-Fahrzeugen, Rechenzentren und 5G-Netze seien weitere Faktoren, die dazu beitragen.
„Beginn eines neuen Elektrizitätszeitalters“
„Die Beschleunigung der globalen Elektrizitätsnachfrage verdeutlicht die bedeutenden Veränderungen, die in den Energiesystemen der Welt stattfinden, und den Beginn eines neuen Elektrizitätszeitalters. Sie stellt die Regierungen aber auch vor neue Herausforderungen, wenn es darum geht, eine sichere, erschwingliche und nachhaltige Stromversorgung zu gewährleisten“, so Keisuke Sadamori, Direktor für Energiemärkte und -sicherheit der IEA.
„Während die Schwellen- und Entwicklungsländer in den kommenden Jahren den größten Teil des Wachstums der weltweiten Stromnachfrage ausmachen werden, wird auch in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften nach einer Zeit der relativen Stagnation mit einem Anstieg des Verbrauchs gerechnet. Die politischen Entscheidungsträger müssen diese sich verändernde Dynamik genau beobachten.“
In den USA wird ein starker Anstieg der Stromnachfrage erwartet, der in den nächsten drei Jahren das Äquivalent des derzeitigen Stromverbrauchs von Kalifornien zum nationalen Gesamtverbrauch hinzufügen wird. Für die Europäische Union wird ein bescheideneres Wachstum der Stromnachfrage prognostiziert, das erst 2027 wieder das Niveau von 2021 erreichen wird, nachdem die Energiekrise in den Jahren 2022 und 2023 einen starken Rückgang verursacht hat.
Laut der IEA wird das Wachstum der emissionsarmen Energiequellen – vor allem der erneuerbaren Energien und der Kernenergie – insgesamt ausreichen, um das Wachstum der weltweiten Stromnachfrage in den nächsten drei Jahren zu decken. Insbesondere wird prognostiziert, dass die Stromerzeugung aus Photovoltaik etwa die Hälfte des weltweiten Anstiegs der Stromnachfrage bis 2027 abdecken wird, unterstützt durch weitere Kostensenkungen und politische Unterstützung. Gleichzeitig soll die Kernenergie ein Comeback erleben und ihre Stromerzeugung im Prognosezeitraum ab 2025 jedes Jahr einen neuen Höchststand erreichen.
Infolge dieser prognostizierten Trends sollen sich die Kohlendioxidemissionen aus der weltweiten Stromerzeugung in den kommenden Jahren voraussichtlich auf einem Plateau einpendeln, nachdem sie bis 2024 um etwa 1 Prozent gestiegen sind.
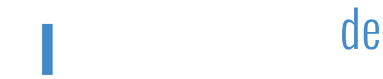

Stefan S meint
Ich hoffe die IEA ist sich klar, das der Atomstrom von neuem Kraftwerken in der EU erst in frühestens 10 vorhanden sein wird. Bis dahin werden Erneuerbare Energien auch mit Batteriespeicher so preiswert sein, das sich die Atom Kraft, wenn nicht ein wirklicher Durchbruch bei den Baukosten kommt sicherlich nicht rentieren wird.
Auch für die Energiesicherheit sind viele kleine Anlagen besser als wenige große.
Mit 50 Raketen kann man Frankreichs Atomkraft schwer treffen. Aber 30.000 Windräder und 100.000 Solarparks sind da eine eher sichere Sache.
eHannes meint
In Europa haben wir zur Zeit die „Ruhe vor dem Sturm“. Wenn in den nächsten 10 Jahren die Elektrifizierung greift, also Strom nicht nur für Mobilität sondern auch für die Gebäudeenergie (Heizung) benötigt wird, wird es eng werden. Dann wird z.B. die Fotovoltaik im Sommer zuviel und im Winter fast nichts liefern. (Off-shore-) Windenergie ist schon besser positioniert, braucht aber noch Stromtrassen. An allen Ecken und Enden fehlen dann (dezentrale!) Speicher. Und noch mehr die grundlastfähigen Kraftwerke, die im Dezember, Januar und Februar enorme Leistungen liefern müssen. Und für all das gibt es noch keinen Masterplan. Immerhin geht das Wasserstoffgeschwafel langsam zuende. Es gibt verdammt viel zu tun! Ab sofort!
M. meint
Quatsch.
Wind- und Solarenergie entstehen zu fast gegensätzlichen Zeiten und ergänzen sich damit grundschätzlich schon mal gut. Das Problem sind tatsächlich die Netze.
Außerdem gibt es natürlich immer Erzeugungslücken, die sogen. „Dunkelflauten“, was rein technisch betrachtet auch Unsinn ist, weil es europaweite Flauten gar nicht gibt – nur halt schon Lücken.
Dafür braucht man aber keine grundlastfähigen Kraftwerke, sondern solche, die schnell einspringen können. Für kleine Lücken (die hat man oft) können das Batterien sein, für große Lücken Gaspeaker. Das Gas dafür kann man sehr gut aus der aktuell schon vorhandenen Biogasproduktion nehmen, das muss man dafür „einfach“ speichern statt in der Grundlast teuer und unsinnig zu verballern.
Da sind dann auch die relativ hohen kWh-Kosten egal, weil die benötigten Mengen zu gering sind, um wirklich auf den Jahresdurchschnittspreis durchzuschlagen. Das macht da wahrscheinlich keinen Cent aus.
volsor meint
Jep , genau so.
eHannes meint
„Das bisschen Strommarkt macht sich von allein, meint der M.“ Man muss schon ganz schön naiv sein, um so zu denken. Wenn man sich fortlaufend informiert gewinnt man ein ganz anderes Bild. Da tritt dann zum Beispiel zutage, dass ein großer Teil des Zubaus der Off-Store-WEA schon mal von den H2-Produzenten „reserviert“ wird, um ein paar Hochöfen und anderes zu ersetzen. Die Stromerzeuger bräuchten genau diese auch. Das Problem ist die Größenordnung der Elektrifizierung! Und bei vielen dominiert noch das Wunschdenken. Die Investitionen werden gigantisch sein müssen. Mit ein paar Biogasspeichern ist es nicht getan. Den Fall, dass zum Beispiel ein Vulkanausbruch großräumig die Fotovoltaik verschattet wollen wir erst gar nicht einbeziehen …
MichaelEV meint
„Und für all das gibt es noch keinen Masterplan“
„Plan“ steht doch für viele für „Plan“wirtschaft. Wenn es der Markt regeln soll, wie viele Wähler es sich wünschen, braucht es keinen Plan.
Finde das mit den Gaskraftwerken auch sehr beachtlich. Überall redet man von Technologieoffenheit, selbst wenn die Technologie zu fast 100% zu erwarten ist, aber bei den Gaskraftwerken hinterfragt niemand, ob diese für den Zweck wirklich die richtige Wahl für die nächsten Jahrzehnte sind.
eHannes meint
Doch, wir brauchen einen „Plan“ -aber keine Marktwirtschaft. Der „Markt“ wird das CO2-Problem nicht regeln, weil er nur kurz- und mittelfristig an Gewinnmaximierung interessiert ist. Das CO2-Problem und die immensen Kosten zu dessen Lösung würde er weiterhin „vergesellschaften“, wenn es keine politische Lenkung gäbe.
Ralf meint
Korrekt!
So wie bei der Kernkraft auch geschehen.
Aber jetzt wird ja der Friedrich den Schalter zur Kernfusion umlegen – tollkühn!
Und für was braucht er den ganzen Strom, wenn wir wieder Dieseltraktoren fahren werden und die Gebäude fossil heizen (und damit hübsch all die Diktatoren weiter unterstützen)?
MichaelEV meint
Klar braucht es zum Teil „Plan“, es ist sinnvoll die absehbaren Technologien proaktiv zu pushen. Der Masterplan bleibt aber immer die CO2-Bepreisung.
Ob die Kraftwerke („grundlastfähig“ ist natürlich Unsinn) als „Plan“ sinnhaft sind, ist sehr fraglich.