Batterieexperte Heiner Heimes, Mitglied der Leitung des Lehrstuhls „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) an der RWTH Aachen, analysiert mit dem Portal Elektroauto-News die Ursachen wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Branche und beschreibt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Europa bis 2030 eine tragfähige Batterie-Industrie aufbauen kann.
Laut Heimes stehen europäische Unternehmen aktuell vor fünf zentralen Herausforderungen: Der Vorsprung asiatischer Konkurrenten, fehlendes eigenes Know-how, hohe Investitionskosten, immense operative Anfangskosten und eine unterschätzte Lernkurve („Tal der Tränen“). Besonders kritisch seien die hohen Ausschussraten beim Produktionsstart, die massive operative Verluste verursachen können. Viele Unternehmen hätten diesen Anlaufprozess zu wenig berücksichtigt.
Ein zentrales Problem ist für Heimes das Fehlen klarer politischer Rahmenbedingungen. Förderprogramme seien zwingend erforderlich, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, wo Unternehmen massiv vom Staat unterstützt werden. „Wenn wir uns vom asiatischen Markt emanzipieren möchten, brauchen wir eine ähnlich starke Förderung der Batterie-Branche“, fordert Heimes und warnt vor politischer Halbherzigkeit. „Es muss in Deutschland und Europa endlich geklärt werden, ob wir eine Unabhängigkeit von Asien erreichen möchten. Wenn ja, dann bitte klotzen!“
Größte Schwäche Europas im Vergleich zu Asien ist laut dem Experten der Mangel an Erfahrung. Diese müsse systematisch aufgebaut werden. Entscheidend sei der Bereich der Zellproduktion, denn hier findet die eigentliche Wertschöpfung statt. Größe, Reichweite und Kapazität einer Batterie hängen maßgeblich von der Zelle ab.
Eigenbedarfsdeckung bis 2030 „inzwischen unrealistisch“
Ob das Ziel realistisch sei, bis 2030 einen Großteil der Batteriezellproduktion in Europa aufzubauen, beantwortet Heimes differenziert. Zwar sei es positiv, dass viele Unternehmen in den letzten Jahren Investitionen gewagt hätten, doch er hält es für unrealistisch, den Eigenbedarf bis 2030 vollständig zu decken. Ein realistisches Ziel sei, 10 bis 20 Prozent der benötigten Zellen selbst zu produzieren – das würde bereits ein strategisches Signal an Asien senden.
Bezüglich der Produktionsstrategie sieht Heimes sowohl großskalige Ansätze als auch spezialisierte Nischenlösungen als notwendig an. Während Massenproduktion zur Kostensenkung beiträgt, könnten spezialisierte Anbieter wichtige Rollen in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt übernehmen.
Kritisch bewertet Heimes die gekürzten Fördermittel. Diese hätten direkte Auswirkungen auf Forschung und Ausbildung. Forschungsgelder seien keine isolierten Investitionen, sondern trügen zur Qualifikation von Nachwuchskräften bei und steigerten insgesamt das akademische Know-how. „Wer an Forschungsgeldern spart, der spart automatisch an der Ausbildung künftiger Ingenieurskräfte und erzeugt dadurch kurz- bis mittelfristig einen Fachkräftemangel in der heimischen Batterie-Industrie“, warnt Heimes.
Recycling und Second-Life-Konzepte spielen aus Sicht von Heimes eine zentrale Rolle für die Zukunft der Branche. Nachhaltigkeit und Rohstoffunabhängigkeit seien ohne funktionierende Recyclingstrukturen nicht zu erreichen. In Europa gebe es keine nennenswerte Rohstoffgewinnung, hier könne eine gut ausgebaute Recycling-Industrie diese Lücke schließen.
Für das Jahr 2030 skizziert Heimes ein Szenario mit klaren Bedingungen: „Maximale“ politische Unterstützung für die Zellproduktion sei unerlässlich. Bleibt diese aus, gefährde das nicht nur die Batterieproduktion selbst, sondern auch nachgelagerte Industriezweige wie Recycling, Industrie- und Anlagenbau. Ohne eigene Zellfertigung sei auch der Betrieb von Test- und Entwicklungskapazitäten in Europa fraglich.
„Wir müssen bis 2030 nicht führend sein – das ist in dieser kurzen Zeit auch gar nicht möglich. Aber wir müssen existieren und mitmischen können. Wenn uns das nicht gelingt, kann das dramatische Konsequenzen haben“, so Heimes abschließend.
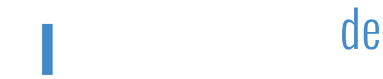

Jeff Healey meint
Forschungsgelder sehe ich kritisch, das ist eigentlich die Aufgabe der Industrie in Zusammenarbeit mit Universitäten, etc.
Die Forschung ist ja auch nicht das Problem in Europa, sondern die Skalierung von Batterie-Produktion („Tal der Tränen“).
Hier braucht es mehr Zusammenschlüsse, mehr gebündelte Kraft, und die weit reichende Unterstützung der EU:
Zitat: „Es muss in Deutschland und Europa endlich geklärt werden, ob wir eine Unabhängigkeit von Asien erreichen möchten. Wenn ja, dann bitte klotzen!“
Michael Ante meint
ich weiß nicht was man hier aufbauen will,
man hat doch eine europäische Antwort mit Northvolt insolvent gehen lassen,
und jetzt haben die schwedischen Behörden den Kauf von Northvolt durch Lyten aus den USA genehmigt !
Future meint
Für die Insolvenz ist Northvolt ganz allein verantwortlich. Die Staaten haben auskömmlich subventioniert. Aber Northvolt hat es nicht geschafft, die Produktion zu skalieren. Da fehlte nicht das Geld, sondern wohl die Expertise.
Lyten ist nun wieder ein kleines Startup ohne Erfahrung in der Skalierung – die haben nur ein Pilotanlage in Amerika und 300 Mitarbeiter. Aber die Hoffnung auf eine eigenständige europäische Produktion sollte man trotzdem haben.
Thyl meint
außerdem meiner Meinung nach die falsche Zellchemie, gerade für einen Premium-Anbieter wie BMW mit Kunden, die gerne schnell fahren. Wer weuiß, ob das BMW nicht auch irgendwann erkannt hat und entsprechend gehandelt.
Michael Ante meint
aber ohne klaren politischen Willen und Aussicht auf ein zukunfstfähiges Geschäftsmodell, wird es mit Hoffnung allein nicht zu machen sein.
Im übrigen mahnt ja der Autor auch wieder eine
„Förderung der Batterie-Branche“ an, also Steuergelder müssen ran !
Peter meint
Wenn Du es tausend mal wiederholst, wird es trotzdem nicht wahr.
Northvolt ist am Geldmangel gescheitert.
Die Wahrheit meint
Der Geldmangel hatte aber ein Grund, der laufende Verträge zu Fall brachte.
Wer nur ankündigt, kassiert und nicht liefert, bzw. nur überwiegend Ausschuss abliefert, den Spukt der Markt schnell wieder aus.
In der Zwischenzeit ging die Entwicklung weiter. Die aktuelle Zelltechnik gibt China für den Export an andere Autobauer nicht frei. Den Wettbewerbsvorteil geben sie nicht aus der Hand, weil die Überproduktion der „alten Ware“ noch an abhängige Abnehmer verkauft werden muss.
So oder so ist der Zug für europäische Batterieprojekte lange abgefahren.
Das ist ein Resultat aus der zögerlichen Strategie, die eher ein Verhinderungsversuch des EAutos in Deutschland war und ist. Dieses Eingeständnis erleben wir gerade mit den Aussagen der dt. CEO und der weitermachen Bitte, das Verbrenneraus zu kappen.
An dieser Stelle sei hingewiesen, dass es nie ein Verbrenneraus gab. Lediglich der Schadstoffausstoß muss reduziert und vor allem die immer schärferen Grenzwerte müssen eingehalten werden. Spätestens beim Dieselskandal haben die Autobauer gezeigt, dass sie völlig versagt haben und mit künftigen Grenzwerten wie Euro 7 und folgende völlig überfordert sind. Der Rettungsversuch mit Hybridtechnik ist ein Strohfeuer.
Future meint
Peter, die Investoren wie BMW haben sich doch zurückgezogen, als klar wurde, dass Northvolt die Skalierung nicht hinbekommt. Geld war also da. Vielleicht war es einfach zu viel Geld, weil Northvolt gleichzeitig an vielen Standorten wachsen wollte. Aber der Wille reicht nicht, wenn die Expertise für die Produktion fehlt. Offenbar ist die Zellproduktion eben in der Praxis viel schwieriger als in der Theorie.
Peter meint
@“Die Wahrheit“ (seltsamer Name übrigens)
Es war eben nicht „nur ankündigen und abkassieren“, sondern man befand sich im relativ normalen Zeit- und Kostenrahmen.
Die Anlaufkosten und Ausschussraten sind international überall ähnlich. In China, den USA und auch in Europa. Die Dauer und die Kosten für diese Anlaufphasen ebenfalls. Das wurde alles in Studien untersucht und publiziert. Die Frage ist lediglich, ob die Entscheider bei und um Northvolt dieses Wissen hatten bzw. in ihrer Konsequenz auch zur Kenntnis genommen haben. Und das war offenbar nicht der Fall, deshalb waren die Erwartungen offenbar überzogen und wurden folgerichtig enttäuscht. Darüber hinaus gab es aber auch (!) Northvolt-spezifische Themen, die waren zwar auch vorhanden, am Ende aber nicht wirklich entscheidend. Von der schlagzeilengeilen Presse darf man sowieso nur wenig Sachkenntnis erwarten, insbesondere bei Redakteuren mit einer fossilen Weltanschauung.
paule meint
Sparen an Forschungsgeldern für Industriebranchen ist richtig. Die Firmen sollen das mal schön selber zahlen. Nur gratis Abschöpfen ist bislang die Devise
Future meint
Die Forschung dazu klappt ja in Europa. Das Problem ist wohl eher, von der grauen Theorie in die Produktion zu kommen. Aber das werden wir alles weiter beobachten. Im nächsten Jahr will PowerCo ja skalieren im Sagunt – allerdings suchen sie dafür nun weitere Investoren. Das muss aber nichts schlimmes bedeuten.
Peter meint
Die Ausschussraten und Anlaufkosten sind global recht ähnlich, auch in China übrigens. Es gibt ein ganze Reihe Studien dazu. Northvolt war keine Ausnahme und PowerCo wird auch keine sein, CATL ist aber auch keine. Die Frage ist, ob die Entscheider von PowerCo das entsprechende Memo gelesen und die Konsequenzen daraus verstanden und ihre Erwartungshaltung an die Realität angepasst haben. Das war bei Northvolt eben nicht der Fall. Deswegen ist dort auch das Geld ausgegangen.
Future meint
Also waren es wohl Managementfehler und Unterfinanzierung bei Northvolt. PowerCo wird das hoffentlich besser machen, wenn sie jetzt noch Investoren suchen. Von ACC hört man allerdings nicht mehr viel.