Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat in dem von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) beauftragten Vorhaben „VoltaVia“ zur Halbzeit erste Erkenntnisse vorgelegt. In dem auf zwei Jahre anberaumten Projekt, bei dem das PEM-Team mit dem Münchener Baulogistik-Dienstleister Zeppelin Rental kooperiert, geht es um die Erarbeitung von Konzepten zur Elektrifizierung von Straßenbaustellen in der gesamten DACH-Region.
Einer weltweiten Vergleichsanalyse von Regionen, Antriebstechnologien und Versorgungskonzepten sowie Experten-Interviews zufolge erzeugen elektrische Baumaschinen deutlich geringere Emissionen und bringen eine einfachere Bedienbarkeit und reduzierte Wartungsaufwände mit sich. In zusätzlichen Erhebungen mit 21 Anwender- sowie zehn Hersteller-Betrieben bestätigten Bauunternehmen jedoch auch höhere Investitionskosten und eine fehlende Lade-Infrastruktur.
960 Tonnen weniger CO2 auf 16 Kilometern
Laut der Untersuchung ist bereits eine breite Palette bislang dieselbetriebener Geräte – von Asphaltfertigern über Hydraulikbagger bis hin zu Radladern – in elektrifizierten Varianten verfügbar oder als Prototyp entwickelt. Kurz- bis mittelfristig werde der Markt von batterieelektrischen Lösungen geprägt sein. Langfristig gewönnen indes Wasserstoffantriebe für Großgeräte mit hohem Leistungsbedarf an Bedeutung.
Den Projektergebnissen zufolge lassen sich auf einer Baustellenlänge von 16 Kilometern durch Elektrifizierung bis zu 960 Tonnen CO2 einsparen. Die „VoltaVia“-Partner erarbeiteten ein Energiebedarfsmodell, das reale Telematik-Daten, Wirkungsgrade und Baustellengrößen miteinander verknüpft und auf diese Weise eine belastbare Prognose des künftigen Strom- und Wasserstoffbedarfs ermöglicht. Darüber hinaus bewerteten die Akteure unterschiedliche Versorgungskonzepte von Schnellladesystemen an Straßenrändern über mobile Batteriespeicher bis hin zu Wasserstoff-Generatoren.
„Die Elektrifizierung von Straßenbaustellen ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich machbar – entscheidend dafür, dass der Mittelstand bei der Dekarbonisierung den Anschluss nicht verliert“, sagt PEM-Leiter Achim Kampker. Im zweiten Jahr des Projekts sollen die Ausschreibung von Großprojekten und die Untersuchung von Auswirkungen auf die Bauwirtschaft im Fokus stehen. Ziel sei es, praxisnahe Lösungen aufzuzeigen, die eine breite Umsetzung der Elektrifizierung von Straßenbaustellen für einen effizienteren und klimafreundlicheren Betrieb ermöglichen.
Finanziert wird das Vorhaben von der „D-A-CH Verkehrsinfrastrukturforschung“ sowie auf deutscher Seite vom Bundesministerium für Verkehr, aus Österreich vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und auf schweizerischer Seite vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).
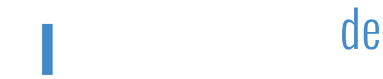

Martin meint
Der erste gute Schritt wäre es ja wenn überhaupt mal gearbeitet wurde auf der Baustelle. Normal läuft das so ab: Einrichten der Baustelle, dann 6 Monate Pause, dann werden die Bagger gestellt, dann kommen die Sommerferien, dann wird die Baustelle eingemessen angefangen zum Baggern bevor Herbstferien sind, mit dem ersten Bodenarbeiten kommt dann der Frost… und dann steht auch schon das Christkind vor der Tür… 🥳
La dolce vita 🤡
Favone meint
Würde schon reichen wenn man in 3 Schichten baut wie im europäischen Ausland zum Beispiel Niederlande.
Hier ist ein Baustelle auf unserer Autobahn wo 2 Auffahrten saniert werden. Bauzeit schon 6 Monate. Freitags ab 13 Uhr keine Bauarbeiter mehr und in der Woche ab 18 Uhr. Kein Wunder das Kosten explodieren..
E.Korsar meint
Klar, in drei Schichten mit mehr Personal und den zusätzlichen Kosten für Nachtarbeit wird es bestimmt billiger. /i
Ganz schlimm sind ja die Leute von der Müllabfuhr. Die arbeiten nur einen Tag in der Woche vor deiner Tür.
Favone meint
Warum geht das im Ausland, wie den Niederlanden und der Schweiz mit höheren Löhnen und weit geringeren Baukosten?
E.Korsar meint
Geht es nicht. Die Baukosten sind bei 24-Stunden-Bau höher, aber das ganze wird mit Senkung der externen Kosten (wie Staukosten und volkswirtschaftliche Schäden durch Verkehrseinschränkungen) begründet.
Das hast du oder deine Quelle wohl verwechselt.
Yoshi meint
Also ist es inkl. externer kosten nun doch günstiger?
Frag mal bei der tagesschau nach, die werden dir die allgemeingültige Wahrheit gern mitteilen.
Martin meint
Corsa
…
Überstunden kosten 30%.
Da eh jeder staatliche Auftrag doppelt und vierfach kostet, isses ja auch egal.
Und statt z.B zehn Baustellen anzufangen könnte man da sammeln und das ganze Personal konzentrieren. All diese Firmen arbeiten sowieso europaweit
Peter meint
Ich denke, die Vergaberichtilinien sind Teil des Themas.