Professor Heiner Heimes ist Leitungsmitglied des Lehrstuhls „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen. In einem ausführlichen Interview mit der Welt sprach er darüber, wie in Deutschland eine wettbewerbsfähige Batterieproduktion für die Elektromobilität aufgebaut werden könnte.
Aktuell scheint es die Fertigung von Elektroauto-Akkus in Europa schwer zu haben. Mit Northvolt, das auch in Deutschland eine Fabrik bauen wollte, ist kürzlich ein ambitioniertes Vorhaben gescheitert. Und Porsche will seine Tochter Cellforce bei Tübingen möglicherweise schließen. Der Mutterkonzern Volkswagen möchte mit der Tochter PowerCo weiter im großen Stil E-Auto-Akkus produzieren, kämpft aber noch mit Herausforderungen. Auch bei dem Stellantis-Mercedes-TotalEnergie-Gemeinschaftsunternehmen ACC läuft es nicht wie erhofft.
Unterschätzte Hürden in der Akkuproduktion
Nach der zwischenzeitlichen Aufbruchsstimmung habe sich die Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten dramatisch umgekehrt, sagte Heimes. Das liege vor allem auch daran, dass vielerorts die Lernkurve nicht genügend einkalkuliert wurde. Man habe für das „Tal der Tränen“, durch das man zwangsläufig erst einmal gehen müsse, nicht gut genug geplant. Einige hätten nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Massenproduktion viel komplexer ist als die Herstellung von Prototypen – und dann sei schlichtweg das Geld ausgegangen.
Eine große Akkufertigung in Europa gilt weiter als notwendig, da sonst die langfristige Abhängigkeit von den aktuell den Markt beherrschenden chinesischen Unternehmen droht. Der RWTH-Professor glaubt, dass in Europa und auch Deutschland weiter Potenzial besteht – um dieses zu realisieren, müsse man in die Erforschung, Entwicklung und Produktion der Batteriezellen-Technologie investieren. Das Geld sei in Deutschland und Europa durchaus vorhanden – aber den jüngsten Entwicklungen zufolge werde es schwierig, privates Kapital in ausreichender Höhe zu mobilisieren.
Staatliche Unterstützung und europäische Kooperation nötig
Konkret sieht Heimes zwei Ansätze. Der Erste ist, dass der Staat die Preisdifferenz, die es zwischen heimischen und den günstigeren Batterien aus Asien gibt, für einen gewissen Zeitraum finanziell überbrückt. Kostet ein Batteriemodul hierzulande noch 100 Euro und das aus Asien 70 Euro, sollte der Staat das eine Zeit lang ausgleichen. „Das deutsche Modul wird auf 90, auf 80 und dann ebenfalls auf 70 Euro sinken – idealerweise also, bis wir auf Augenhöhe sind. Die Mehrkosten heimischer Batteriezellen sind der Gegenwert unserer Unabhängigkeit“, so der Branchenexperte.
Deutschland und Europa hätten weiter die Chance, auf Augenhöhe mit Asien zu gelangen, glaubt Heimes. Hier komme er zu seinem zweiten Vorschlag: „Wir müssen bei der Batterie europäisch denken, so wie beim Flugzeug Airbus, das ja ein europäisches Erfolgsmodell ist.“ Vergleichbar mit der multinationalen Airbus-Produktion könnten Teile der Zellen in Deutschland, Frankreich oder Spanien und die fertigen Zellen auch dort oder in einem weiteren Land produziert werden. Wenn ein rundum europäisches Produkt gelinge, dürfte ein Ausrollen der Produktion in industrielle Größenordnungen kein existenzielles Problem mehr sein.
Digitale Werkzeuge werden laut Heimes in der Batterieproduktion entscheidend sein. Das fange bei der Planung der Fabriken an, wo sogenannte digitale Zwillinge von vornherein das Produktions-Layout so effizient und kostengünstig wie möglich gestalten können. Auch in nachgelagerten Bereichen könnten digitale Werkzeuge sehr helfen – zum Beispiel bei der Rückverfolgbarkeit entscheidender Batterie- und Produktionsdaten. Mithilfe künstlicher Intelligenz könne man praktisch alle Bereiche der Batteriezellenproduktion optimieren.
Die Asiaten – neben China auch Korea und Japan – haben einen enormen Erfahrungsvorsprung bei Akkus. Das lässt sich laut Heimes nicht so schnell aufholen. Aber es gebe andere, essenzielle Bereiche in der Batterieproduktion, in denen sich europäische Hersteller vom Wettbewerb aus Asien abgrenzen und Vorteile auf dem Weltmarkt verschaffen können. Dazu gehörten klimafreundliches Recycling oder hochgradig kosten- und energiesparende Produktionsprozesse.
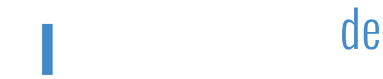

LMdeB meint
Konjunktiv „könnte“ sollte es in der Überschrift wohl eher heißen als “ … wettbewerbsfähig machen kann“.