Die Produktion von Elektroauto-Batterien ist nach wie vor energieintensiv und trägt erheblich zum gesamten CO₂-Fußabdruck von entsprechenden Fahrzeugen bei. Ein neues Whitepaper der Unternehmensberatung P3 beleuchtet die aktuelle Lage.
Frühere Analysen zeigen, dass E-Fahrzeuge mit dem aktuellen Strommix der EU erst nach etwa 80.000 bis 120.000 gefahrenen Kilometern eine CO₂-Parität mit Verbrennerfahrzeugen erreichen – bei Nutzung von 100 Prozent erneuerbarem Strom bereits nach 40.000 bis 70.000 Kilometern, abhängig von Batteriegröße und Produktionsparametern.
Die neue Studie von P3 untersucht die Hauptemissionsquellen entlang der Batteriewertschöpfungskette – von der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung über die Produktion bis hin zum Recycling – und identifiziert Potenziale für „erhebliche“ Emissionsreduktionen.
„Regulatorische Rahmenbedingungen wie der EU-Batteriepass sowie technische Fortschritte – etwa die Integration erneuerbarer Energien, innovative Produktionsmethoden und verbessertes Recycling – bieten einen Weg zur weitreichenden Dekarbonisierung“, so die Analysten. Durch Optimierung dieser Prozesse könnte der Emissionswert bei der Batterieproduktion von derzeit etwa 55 kg CO₂e/kWh auf bis zu 20 kg CO₂e/kWh sinken.
Dadurch würde der CO₂-Ausgleichspunkt eines beispielhaften E-Fahrzeugs gegenüber einem Verbrennerfahrzeug bereits nach rund 50.000 Kilometern erreicht – beim aktuellen EU-Strommix – beziehungsweise sogar unter 30.000 Kilometern bei 100 Prozent Ökostrom, anstelle von bisher rund 95.000 Kilometern.
Diese Entwicklung gewinne vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen in der EU deutlich an Relevanz – insbesondere ab 2028, wenn Akkuhersteller gesetzlich verpflichtet sein werden, CO₂e-Emissionen unter bestimmte Schwellenwerte zu senken. „Sie könnte zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal entlang der Batterie-Wertschöpfungskette werden“, sagen die P3-Experten.
Fazit
Die Autoren des Whitepaper unterstreichen, dass Elektrofahrzeuge bereits „eine starke Option“ für nachhaltigen Verkehr darstellten. Durch kontinuierliche Innovation und ein Bekenntnis zur Transparenz könnten sie noch umweltfreundlicher werden. Um die Dekarbonisierung entlang der gesamten Batteriewertschöpfungskette zu beschleunigen, müssten die Akteure:
- Transparenz in der Lieferkette stärken: Die vollständige Implementierung eines „Battery Passport“ (Batterie-Pass) ermögliche es den Beteiligten, Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen und zu optimieren.
- Erneuerbare Energien nutzen: Der Umstieg auf erneuerbare Energien in der vorgelagerten Materialgewinnung, der Batterieproduktion und dem Recycling könne Emissionen deutlich senken und die Einhaltung strengerer Vorschriften ermöglichen.
- Produktionsmethoden innovieren: Die Skalierung von Technologien wie der Trockenelektrodenbeschichtung sowie der Ersatz von CO₂-intensiven Materialien durch emissionsarme Alternativen könne die Emissionen in der Herstellung erheblich reduzieren.
- In nachhaltige Ausrüstung und Bauweise investieren: Der Einsatz nachhaltigerer Materialien beim Design von Ausrüstung und Gebäuden sowie die Optimierung von Produktionsprozessen würden die grauen Emissionen der Maschinen und den langfristigen Energieverbrauch im Betrieb senken.
- Kreislaufwirtschaft fördern: Der Ausbau der Recyclinginfrastruktur – insbesondere für hydrometallurgische und direkte Recyclingmethoden – ermögliche höhere Rückgewinnungsraten und geringere CO₂-Fußabdrücke für Materialien wie Lithium und Kobalt.
„Durch die Umsetzung dieser Strategien kann die Branche eine vollständig nachhaltige Batteriewertschöpfungskette erreichen“, so P3. „Zukünftige Überlegungen umfassen die Bewertung der Emissionen im Zusammenhang mit dem Bau von Gigafabriken sowie die Prüfung alternativer Batterietechnologien wie Festkörper- und Natrium-Ionen-Batterien.“
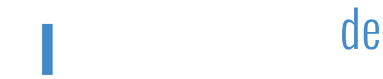

Kirky meint
An sowas hat Hilti-Niklas kein Interesse, der muss 500 km mit 200 km am Stück fahren für ein 30 Minuten Meeting, weil seinem Arbeitgeber niemand gesagt hat das es sowas wie Teams gibt.
M. meint
500 km mit 200 km am Stück?
Also laden nach 200 und 400 km? Oder was?
Für 30 Minuten Meeting? Woher weißt du das?
Hat dir Niklas das erzählt?
Thomas meint
„Frühere Analysen zeigen, dass E-Fahrzeuge mit dem aktuellen Strommix der EU erst nach etwa 80.000 bis 120.000 gefahrenen Kilometern eine CO₂-Parität mit Verbrennerfahrzeugen erreichen“
Diese Zahlen sind vollkommen veraltet! Mit dem aktuellen Strommix liegt man eher bei 20-30.000km -und das auf Basis von Akkus mit einem Abdruck von 65 kg CO2e/kWh. Unten spricht die Studie dann von 95.000km bei 55 kg CO2e – das ist völliger Unsinn und passt nicht zusammen.
Bei einer Reduktion auf 20 kg CO2e fallen nur noch 1.000kg CO2e für ein Fahrzeug mit 50kWh Akku an – dann dürfte man auch auf Herstellungsseite des Fahrzeugs auf Verbrenner-Niveau sein und es überhaupt keinen „Rucksack“ mehr geben den man abfahren muss.
Leute, vergesst diesen Unsinn der „Unternehmensberatung P3“ und schaut auf die Zahlen renommierter Unis oder Forschungsinstitute.