Die EnBW-Tochter Netze BW hat nach Abschluss seines Feldversuchs ein positives Fazit gezogen: Die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge lasse sich erfolgreich in Tiefgaragen von bestehenden Mehrfamilienhäusern integrieren. Ein intelligentes Lademanagement sei dabei hilfreich, teilte der Netzbetreiber mit.
Ergänzend zu theoretischen Modellen spielt die Netze BW Szenarien für das Aufladen von Elektroautos in der Realität in sogenannten Netzlaboren durch. In einem 16-monatigen Feldtest, dem „E-Mobility-Carré“ in Tamm bei Ludwigsburg, wurde untersucht, ob die bisherige Anschlussleistung auch für nachträglich in der Tiefgarage installierte Ladestationen noch ausreicht. Beziehungsweise, wie man bestenfalls ohne zusätzliche Netzverstärkungsmaßnahmen mit dem bestehenden Hausanschluss auskommt, und zwar ohne Komforteinbuße für die Bewohner. Die Untersuchungen sind nun abgeschlossen.
Anlass für den Test war die Mobilitätswende als Teil der Energiewende. Bis zum Jahr 2030 müssen in Deutschland laut einer Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur rund 15 Millionen E-Fahrzeuge in das Stromnetz integriert werden. „Deutschlands Automobilindustrie befindet sich mitten in einem fundamentalen Transformationsprozess, den die Hersteller allein gar nicht stemmen können. Da sind gleichermaßen Politik und Wissenschaft aber auch andere Wirtschaftszweige wie die Energiebranche gefragt“, so Dr. Martin Konermann, Technischer Geschäftsführer der Netze BW. „Wir sind zu diesem Schulterschluss gerne bereit, um einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten.“ In Projekten wie dem in Tamm werde die Grundlage dafür geschaffen. Damit die E-Mobilität hierzulande eine Erfolgsstory wird, brauche es ein leistungsfähiges und weiterhin zuverlässiges Stromnetz.“

Für ihr Netzlabor in Tamm hatte die Netze BW die Tiefgarage der Wohnanlage „Pura Vida“ im vergangenen Jahr mit Ladepunkten ausgestattet und den Teilnehmern vorübergehend 45 Elektroautos für den täglichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. „Ob Familien mit Kindern, Paare oder Rentner, ob Gelegenheits- oder Vielfahrer – sie alle hatten ihren Benziner oder Diesel zeitweise ‚eingemottet‘ und waren von heute auf morgen elektrisch unterwegs. Mit wachsender Begeisterung. Im Schnitt brachte es jeder dieser Elektropioniere auf eine monatliche Fahrleistung von 1.100 Kilometer. Trotz Homeoffice und coronabedingten Einschränkungen ein beachtlicher Wert“, so die Projektverantwortlichen.
Lademanagement glättet Lastspitzen
In dem Projekt ging es im Schwerpunkt darum, wie sich der Hausanschluss von Mehrparteien-Wohnobjekten für den zusätzlichen Verbrauch durch Ladestationen optimieren lässt. Ein idealer Anschluss stellt ausreichend Leistung zur Verfügung, ohne überdimensioniert zu sein. Letzteres wäre allerdings der Fall, wenn man davon ausgehen würde, dass alle E-Autos zur selben Zeit geladen werden. Im E-Mobility-Carré zeigte sich, dass nie mehr als 13 Ladevorgänge parallel stattfanden – bei insgesamt 58 zur Verfügung stehenden Ladepunkten. Die sich auf das Netz belastend auswirkende „Gleichzeitigkeit“ betrug also lediglich 22 Prozent. Damit lag der Wert noch deutlich unter den bei einem ähnlichen Feldtest in Ostfildern gemessenen 50 Prozent. Fast während der Hälfte der Zeit wurde überhaupt kein Auto geladen.
Die Ergebnisse zeigen laut Netze BW das Potenzial von flexibilisierten Ladevorgängen. Wichtigstes Instrument dafür sei ein für das Projekt installiertes intelligentes Lademanagementsystem. Damit habe die Anschlussleistung der Ladepunkte abgesenkt und so Lastspitzen reduziert werden können. Bestehende Netzanschlüsse von Mehrfamilienhäusern könnten dadurch optimal ausgenutzt werden. Darüber hinaus gebe ein intelligentes Lademanagement Netzbetreibern Zeit für sinnvolle, effiziente und nachhaltige Netzverstärkung. Dafür müsse lediglich zeitweise eine etwas längere Ladezeit in Kauf genommen werden. Über 90 Prozent der Projektteilnehmer hätten sich dadurch „überhaupt nicht“ eingeschränkt gefühlt, habe das E-Mobility-Carré gezeigt.
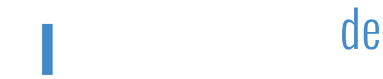

Sebastian meint
Wer konnte das vorher wissen, das tatsächlich Strom aus der Steckdose kommt?! Autos lassen sich laden… wirklich? Bei dem Versuch sind auch weder Tiere noch Menschen zu schaden gekommen oder gar verstorben. Respekt!
Spass beiseite…
Für Wohnkomplexe würde ich eher ein paar HPCs installieren, als jedem Dödel sein eigenes Kabel! Elektriker sind eh schon auf Monate ausgebucht.. da macht es deutlich mehr Sinn gleich richtige Kabel zu verbauen, als für jeden Otto Meier Müller einen Genehmigungsverfahren für sein lustiges privates Kabelchen zu beantragen. Aber so sind wir Deutsche eben, immer klein klein klein denken.
Stefan meint
Man braucht doch nicht für jedes Kabel/Steckdose ein eigenes Genehmigungsverfahren. Höchstens ein eigenen Förderantrag – wenn es jeder Mieter selbst zahlen würde – was hier aber sicher nicht der Fall war.
HPCs gehören auf die Straße/für alle zugänglichen Parkplatz und nicht in die Tiefgarage. Einige wenige HPC können schnell mehrere Stunden blockiert werden von Langsamladern.
Sebastian meint
HPC sind CCS Kabel…
Auch sprach ich nicht von HPC in Tiefgaragen.. wobei sogar Tesla diesen Weg immer mehr geht! Vermutlich weil die etwas weiter denken als Klein Müller Maier.
Es ist ja fein, wenn der EFH Besitzer sind persönliches Kabelchen hat, mehr als die 70% der Autofahrer haben aber überhaupt keinen eigenen Stellplatz!
Wenn wir also 2030 Verbrenner verbieten wollen, brauchen wir etwas krassere Konzepte. Siehe Umsetzung von EnBW
Sebastian meint
Versuch mal ein einer WEG Behausung an deinem Tiefgaragenstellplatz eine Wallbox zu verbauen. Im besten Fall kostet das mehrere Tausend Euro, ja nachdem wo der Verteiler im Gebäude ist und wie viele Brandschottungen zu machen sind. Jetzt wollen 10 andere das gleich auch…
also da ist es mir rein von den Kosten lieber, wenn am Einkaufscentrum 20 Supercharger oder HPC installiert sind… einstecken, 45 Min. shoppen und der Akku ist voll. An solchen Gebäude ist es auch kein Problem mal eben 2 oder 3 MW Leistung abzurufen, ganz im Gegenteil zu Bestandsgebäude die älter als 20 Jahre sind… da scheitert man bereits nach der 8ten Wallbox.
Löthar meint
Nichts leichter als das: Die förderfähige, für Lastmanagement vorbereitete Wallbox kostet 750 €, der Elektriker will 450 € incl. 15 m Leitungsverlegung, die KfW gibt 900 €, macht unterm Strich 300 € für mich, und ich kann laden, wann ich will.
Sebastian meint
Löthar
Wow. Bei Ihnen steht der Verteilerschrank direkt in der Tiefgarage. Ich staune!
Mund meint
Wo bleibt die Möglichkeit Laternen zu nutzen, da könnte man auch über Nacht, mit geringer Leistung, laden. Was ja auch für die Akkus besser wäre als in kurzer Zeit viel auf den Akku zu bekommen. Die Aufladung unterwegs (was die Ausnahme sein sollte) ist ja nur erforderlich bei Reisen über längere Strecken. Hausanschlüsse haben doch die wenigsten, in Städten. Die meisten Parkplätze sind doch über 20m von der heimischen Steckdose entfernt aber eine Laterne steht alle 50m.
Christian Brinker meint
Iwie war das Ergebnis doch klar. Die meisten kommen abends gegen 18h nach Hause. Dann lädt derjenige, der Bedarf hat und steckt am nächsten morgen frühestens gg 6 oder 7 Uhr morgens wieder ab. Durchschnittlicher Bedarf dürften dann 30-40 kWh/Fahrzeug sein, da man ja meistens nicht mit „0“ ankommt. Das heißt in den 12 Stunden kann man ganz viel glätten, ohne einzuschränken und ohne das Netz zu belasten. Sehr schön, dass das jetzt auch einmal im Feldversuch bestätigt worden ist.
Sebastian Schille meint
Also bei durchschnittlich 1100km/Monat sind es sind es 7,3kWh/Fahrzeug wenn man mal von hohen Verbräuchen von 20kW/100km ausgeht. Also eher noch weniger.
Sebastian meint
jo… vor 18 Uhr ist NIEMAND daheim. Keiner! Alle unterwegs…
JürgenSchremps meint
Super. Zeigt, dass alle Bedenken vollkommen unberechtigt sind. Der Umstieg auf Elektromobilität wird in der Breite ohne Einschränkungen möglich sein, selbst in der Stadt.
Peter W meint
Das zeigt wieder einmal, dass das E-Auto völlig problemlos ins Netz eingebunden werden kann. Wenn man nun noch bedenkt, wie viel PV-Fläche da noch auf den Dächern zur Verfügung steht, und wie gut man die Autoakkus netzdienlich einbinden könnte, dann erübrigt sich jegliche Kritik an der E-Mobilität
Julius meint
Der letzte Satz ist der interessanteste.
Gibt es noch mehr Infos über die Beeinträchtigung durch das Lademanagement zu Spitzenzeiten?