Die europäische Automobilindustrie steht laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey vor der größten Bewährungsprobe ihrer Geschichte. Durch den Übergang zur Elektromobilität und softwarebasierten Fahrzeugen, ungünstige Standortbedingungen sowie neue Wettbewerber und Handelsbedingungen könnten bis 2035 bis zu einem Drittel der Wertschöpfung der Industrie – 440 Milliarden Euro – auf dem Spiel stehen.
Um wettbewerbsfähiger, resilienter und nachhaltiger zu werden, investiert die Industrie den Beratern zufolge schon heute 150 Milliarden Euro jährlich in Zukunftstechnologien wie E-Mobilität und softwarebasierte Fahrzeuge.
Um im Wettbewerb mitzuhalten, sollte die Industrie auch ihre Entwicklung deutlich beschleunigen und Kosten senken. Zudem gelte es, eine wettbewerbsfähige europäische Batteriewertschöpfungskette aufzubauen und Partnerschaften für kritische Rohmaterialien zu schließen.
Außerdem sollten die Rahmenbedingungen für die Industrie verbessert werden: durch den massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur, eine Verbesserung der Faktorkosten am Standort Europa sowie eine realistische Diskussion um den effizientesten Weg zur Klimaneutralität.
„Trotz des Gegenwinds – die europäische Autoindustrie ist mit ihrem Beitrag von 7 % zum europäischen Bruttoinlandsprodukt immer noch das Rückgrat der europäischen Volkswirtschaft“, sagt Harald Deubener, Co-Autor der Studie und Leiter der weltweiten Automobilberatung bei McKinsey. „Allerdings machen die ungünstigen geopolitischen Faktoren und die im Vergleich zu China und den USA schwierigeren Standortbedingungen die Transformation komplex.“
Die Industrie steht laut McKinsey vor einigen Herausforderungen:
- Technologie: Aktuell entsteht bei einem in Europa hergestellten und verkauften Fahrzeug mit Verbrennungsmotor 85-90 % der Wertschöpfung in Europa. Bei einem von einem europäischen Hersteller in Europa produzierten batterieelektrischen Fahrzeug sinkt der Anteil auf 70-75 %, da vor allem die Batterien oft aus Asien bezogen werden. Ein von einem nicht-europäischen Hersteller in Europa produziertes E-Auto liegt noch bei 55-60 %, ein importiertes batterieelektrisches Fahrzeug nur noch bei 15-20 % Anteil europäischer Wertschöpfung.
- Marktanteile: Europäische Hersteller haben seit 2017 ein Fünftel ihres weltweiten Marktanteils verloren. Mit 24 % Marktanteil liegen europäische Anbieter nun gleichauf mit chinesischen Herstellern und Tech-Unternehmen.
- Geopolitik: Die Energiepreise sind in Europa doppelt so hoch wie in den USA und China. Zudem ist die Abhängigkeit von China bei Batterien hoch: 80 % der weltweiten Wertschöpfungskette wird von China dominiert. Außerdem kommen 95 % der Importe von seltenen Erden aus China.
- Regulatorisches Umfeld: Die Genehmigungszeiten sind in Europa dreimal so lang wie in den USA und zehnmal so lang wie in China, Zudem gibt es doppelt so viele regulatorische Vorgaben, die auf die Autoindustrie einwirken.
„Die europäische Autoindustrie steht immer noch auf einem starken Fundament – auf dieser Basis muss sie jetzt aber mutig umsteuern“, so Patrick Schaufuss, Co-Autor der Studie und Partner bei McKinsey.
Die Studie nennt neun Handlungsfelder, auf die es jetzt ankommt:
- Produktoffensive: Bis 2032 plant die Industrie, 350 neue E-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen und investiert dafür aktuell 150 Milliarden Euro im Jahr – sowohl in Forschung & Entwicklung als auch in neue Fertigung, z.B. für Batterien.
- Kostenposition und Schnelligkeit: Neue Anbieter warten mit Fahrzeugpreisen auf, die 20 bis teilweise 50 % unter denen etablierter Unternehmen liegen. Chinesische Hersteller haben ihre Produkteinführungszeiten zum Teil auf nur zwei Jahre verkürzt – europäische Anbieter brauchen oft doppelt so lang.
- Regionale Kundenorientierung: Die Kundenvorlieben unterscheiden sich weltweit erheblich – einheitliche globale Fahrzeugplattformen funktionieren nicht mehr. Nur 18 % der Chinesen geben an, dass ihr nächstes Fahrzeug ein Verbrenner sein wird – verglichen mit 49 % in Europa und 70 % in den USA. Zudem sind fortgeschrittene Fahrassistenzsysteme für chinesische Käufer – vor allem im Premiumsegment – ein wichtiges Kaufkriterium; deutlich stärker als in Europa.
- Batterien: Europa steht aktuell nur für 10 % der Zellproduktion. Um einen Paradigmenwechsel einzuleiten und den Bedarf von 600 bis 800 GWh 2030 zu decken und unabhängiger zu werden, bedarf es einer engeren Zusammenarbeit von Herstellern, Zulieferern und politischen Entscheidungsträgern. Gezielte Partnerschaften und Technologietransfer mit den führenden Anbietern können helfen, um mithalten zu können.
- Zukunftsfelder: Europa sollte in sieben erfolgskritischen Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen. Bei E-Antriebssträngen ist der Markt mit über 50 Anbietern aktuell stark fragmentiert – eine Konsolidierung und Standardisierung ist vonnöten. Zudem ergeben sich auch aus dem Komponentenmarkt für Verbrenner immer noch Chancen – dieser wird 2035 über 100 Mrd. Euro groß sein. Auch eine Vorreiterrolle bei alternativen Kraftstoffen bietet sich an. Zudem wird sich der Wertbeitrag von assistiertem und autonomen Fahren bis 2035 vervierfachen – nötig dafür ist auch eine starke Softwarekompetenz. Hier liegen neue Unternehmen mit 40 % Anteil von Softwareingenieuren innerhalb der F&E-Funktion vorne. Chancen gibt es auch bei der Halbleiterproduktion – weniger als 10 % der Front-End-Produktion liegt in Europa; und bei der Kreislaufwirtschaft: Die Hälfte der Batterien könnte 2040 aus recyceltem Material hergestellt werden.
- Rohstoffe: Von den von der EU identifizierten 34 kritischen und strategischen Rohstoffen sind 25 relevant und 14 unabdingbar für die Autoindustrie. China kontrolliert viele dieser Rohstoffe – 40 % der globalen Minenkapazitäten für Batteriematerialien und 80 % des Refinings. Lokale Kapazitäten und neue Partnerschaften könnten helfen, die Abhängigkeit zu reduzieren. Zudem gilt es, stärker auf nachhaltig abgebaute Rohstoffe zu setzen.
- Infrastruktur: Um Europa auf einen nachhaltigen Nullemissionspfad zu bewegen, muss die Ladeinfrastruktur um den Faktor 6 bis 2035 ausgebaut werden – 350 Mrd. Euro sind dafür notwendig. Schnellere Genehmigungszeiten sind vonnöten, außerdem ein Ausbau des Stromnetzes an neuralgischen Punkten.
- Emissionen: Europa hat ambitionierte Dekarbonisierungsziele gesetzt – allerdings entwickelt sich das E-Auto-Ökosystem noch nicht so schnell wie nötig, um diese Ziele zu erreichen. Nur 20 % der Käufer in Europa erwägt ein batterieelektrisches Fahrzeug. Wenn diese Zurückhaltung anhält, kann dies zu einem starken Altern der Verbrennerflotte auf den Straßen mit entsprechend hohen Emissionen führen – der sogenannte „Havanna-Effekt“. Eine Diskussion über den effizientesten Pfad hin zur Nullemissionsmobilität – durch günstigere E-Autos und ein breiteres Portfolio an Hybriden (von Plug-in-Hybriden bis hin zu Range Extendern) sowie der Kompensation möglicher Restemissionen – kann helfen, einen wirtschaftlich tragfähigen Übergang zu gestalten.
- Faktorkosten: Hohe Energie- und Produktionskosten beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller und Zulieferer massiv – Initiativen zur Reduzierung dieser Kosten hätten einen signifikanten Effekt. Zudem könnten maßgeschneiderte Programme zur Anwerbung von Talenten für Zukunftsthemen, gezielte Förderprogramme rund um die E-Mobilität sowie Innovationszentren helfen, die globale Wettbewerbsposition zu verbessern.
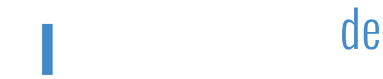

Martin meint
Gibt zwei Gründe für die Probleme
1. man hat sich zu sehr auf China verlassen und
2. hat man die Produkte bedingt durch Punk 1 an den heimischen Kunden vorbeientwickelt
jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten:
1. man „holt Stöckchen“ wie ein Hund um den Chinesen zu gefallen oder
2. man besinnt sich auf den heimischen Markt – eben mit einer Reduktion an Umsatz
so wie ich das sehe, macht man Punkt 1 mit der Gefahr das China dennoch noch laufen wird, weil die jetzt so weit sind, bessere Produkte für sich zu machen. Damit verliert auch weiter an Punkt 2.
Martin meint
das China dennoch NICHT laufen wird
David meint
Eine Unternehmensberatung möchte Beraterstunden verkaufen. Daher findet sie unfassbar viele Handlungsfelder und natürlich kann sie in jedem Feld helfen. Ich denke aber, aktuell können sie weniger helfen, als je zuvor. Warum?
Defacto ist man in einer Wirtschaftskrise, das ist der erste Grund, warum das Geschäft gerade nicht so gut läuft. Zweitens, ist das Auto entbehrlicher geworden. Arbeit wird oft aus dem Home-Office per Videokonferenz oder einer Plattform erledigt. Moderne Formen des Einkaufs bieten Vertretern, die ihre Kundschaft abklappern, keinen Vorteil mehr. Ebenso sinkt die Führerscheinquote. Neue Märkte wie China haben überhaupt keine Tradition, für die Arbeit das Auto zu nutzen.
Auf der anderen Seite hat man perspektivisch gar nicht die Arbeitskräfte, um die Wertschöpfung vollständig in Europa und schon gar nicht in Deutschland durchzuführen. Es wäre also schlau wenn der Teil der Wertschöpfung, der besonders lukrativ ist, bei uns stattfindet. Das ist Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb. Und das passiert.
Ganz zuletzt, ist es zwar Mode, mit Superlativen um sich zu werfen. Aber es ist keine große Bedrohung von außen feststellbar – die Chinesen kommen nicht an und Tesla ist schon fast Geschichte. Das war früher anders: Die Japaner hatten damals besser gebaute, besser ausgestattete und trotzdem günstigere Autos auf den Markt gebracht. Da konnte man wirklich Beraterstunden verkaufen, um Six Sigma etc. zu lernen, ebenso musste man völlig neu kalkulieren, um die Fahrzeuge besser auszustatten und attraktiver zu gestalten. Als die Koreaner kamen, musste man sogar richtig zaubern, weil die gnadenlos günstig anboten. Da hatte VW zum Beispiel die anstrengende Mehrmarkenstrategie aufgebaut, den Flanker-und Fighter-Brand Ansatz mit Seat, Skoda und Audi als Markendreieck zum Schutz von VW in der Mitte.
Future meint
Natürlich sind die Studien der Berater in erster Linie Eigen-PR. Das ist bei den Studien der Autolobby ja auch nicht anders.
Natürlich brauchen Autoindustrie und Politik weiter dringend die Beraterstunden, damit der Wandel nicht doch noch verzögert wird.
Sonst verkauft Tesla auch in den nächsten Jahren weiterhin mehr Elektroautos als alle VW-Konzernmarken zusammen.
Natürlich gehen die Industriearbeitsplätze alle verloren, so wie es in anderen Industrien auch war, die heute in Billiglohnländern produzieren.
paule meint
„Bis 2032 plant die Industrie, 350 neue E-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen “
Was für ein kranker Wahnsinn. Aber ja, ein bestehendes Midell durch „Abspecken“ fur anderer Käuferschichten attraktiv zu machen ist völlig der falsche Weg, schreiben hier die Experten. Noch mehr Modelle braucht die Welt, und jede Marku muss alle Segmente abdecken. Sonst: „könnendienicht“
Haubentaucher meint
Die europäische Autoindustrie meint eben „Viel hilft viel“, weil man es immer so gemacht hat. Man lernt nichts dazu und kann die veränderte Welt nicht akzeptieren.
paule meint
Das ist wahre Ressourcen-Verschwendung.
Mary Schmitt meint
Es gibt keine anderen Käuferschichten für Tesla, Salatsauce. Tesla ist geächtet, ausgelistet, beschädigt, unakzeptabel. Lies doch mal hier mit bevor du kommentierst.
Andi EE meint
@Mary, David und Co.
„Lies doch mal hier mit bevor du kommentierst.“
Leute wie dich? Der Clickbait-Generator von ecomento.de, ein läppischer Zudiener der hiesigen Autoindustrie.
Dass man dich immer instant veröffentlicht hier und ich zum Teil Tage auf die Veröffentlichung meiner Posts warten muss, spricht doch für die Schieflage der
Neutralität in diesem Medium.
Welche Käuferschichten willst du überhaupt vertreten, die die durch eure Medien so „objektiv“ informiert werden oder die weltweit informierten Kunden von BEVs. Das Problem von euch ist, dass ihr Meinung zensuriert und die fertigmacht, die euch nicht genehm sind.
Future meint
Welche Käuferschichten sind es denn, die 500.000 Teslas in einem Quartal kaufen? Wie verblendet kann man denn nur sein in der deutschen Industrie. Das waren alles Teslas und eben keine IDs. Woran liegt das denn? Es wird das gute Preis-Leistungsverhältnis sein.
Jörg2 meint
Es gibt wohl zuviele kleine Häuptlinge in den alten Strukturen, welche sich für ihre Bedeutung, für ihr Budget, die größe des Büros, die Anzahl der Vorzimmerdamen… Tag täglich bemühen. Da kann „das Große und Ganze“, das eigentliche Produkt… schon mal hinten runterfallen.
Mary Schmitt meint
„Vorzimmerdamen“, alter weißer Mann! Park mal im Kopf um!
Jörg2 meint
Marie
Dann scheint das ja zu stimmen, wenn es nur Kritik an der Wortwahl gibt.
Leckerli
David meint
Du kommst vermutlich von dem Ansatz, dass Tesla ja auch nur zwei Modelle mit gewissen Absatz am Markt hat. Du darfst aber nicht vergessen, Tesla ist dem Untergang geweiht und das Ziel haben andere Hersteller nicht.
Future meint
Geweiht wird in der Kirche. Tesla steht in Deitschland seit 10 Jahren immer vor dem Untergang im nächsten Jahr. Deshalb haben die den Deutschen auch eine Fabrik vor die Nase gebaut, damit die Deutschen sehen, dass die immer noch da sind. Dafür verlagern die alten Hersteller ihre Produktion weg aus Deutschland. Die Gründe kennen wir ja alle.
Andi EE meint
Tja, früher hat an mit dem veränderten Scheinwerfer und bisschen anders gebogenen Blech (Facelift), unfassbar viel Geld verdient. Das ist vorbei.
Und ja, das exzessive Auflegen von neuen Modellen, ist völlig verrückt. Das türmt den Schuldenberg auf und schmälert die Möglichkeiten für wirkliche Innovation massiv.
E.Korsar meint
Diese 2-Modell-Strategie war ja früher wahnsinnig erfolgreich. Trabant 601 und Trabant 601 Universal.
Die Nachfrage war so riesig, dass die Wartezeit ab Bestellung auf 17 Jahre stieg. Müssen tolle Autos gewesen sein. /i
Trabant 601 zu Trabant 601 Universal verhält sich wie Tesla Model 3 zu Model Y. Zur Einordnung für die Jüngeren. ;-)
Mary Schmitt meint
Und stehen auch ähnlich im Konkurrenzvergleich mit Autos aus der BRD da.
Future meint
Modellvielfalt ist allerdings auch kein Erfolgsmodell. Es ist wohl komplizierter geworden als früher in dieser guten alten Zeit. In der Zukunft gibt es vielleicht auch gar keine Modelle mehr.