Auch für Transporter und Lastwagen gelten in Zukunft strengere CO2-Gesetze, die Hersteller von Nutzfahrzeugen investieren daher verstärkt in alternative Antriebe. Daimler Trucks hat kürzlich im Rahmen einer Zukunftsschau in seinem Lkw-Werk Wörth präsentiert, welche Lösungen im Fokus stehen.
Daimler Trucks konzentriert sich bei der Elektrifizierung seines Angebots auf Batterie- und Wasserstoff-Systeme. Teilelektrische Hybridlösungen sind derzeit nicht geplant. „Den Hybridantrieb sehen wir im Zukunftslabor nach wie vor allerdings nicht“, sagte Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner der Branchenzeitung Automobil Industrie. Anders als bei Pkw sei die Wirtschaftlichkeit von Hybrid-Technik bei Lastwagen nicht gegeben.
In den kommenden Jahren bringt Daimler Trucks mehrere neue batteriebetriebene Fahrzeuge auf den Markt – darunter den Leicht-Lkw eCanter sowie den schweren Laster eActros. Bei der Reichweite hält der süddeutsche Hersteller – anders als Elektro-Pionier Tesla – vorerst maximal 200 Kilometer mit einer Akkuladung für realistisch. Deutlich mehr Potential sehen die schwäbischen Ingenieure in wasserstoffbetriebenen Lkw – dazu, wann mit ersten Serienfahrzeugen zu rechnen ist, gibt es bisher keine konkrete Aussage.
Daimler will trotz E-Mobilitäts-Offensive auch bei Nutzfahrzeugen weiter in großem Stil Dieselmotoren einsetzen. Selbstzünder lassen sich zwar nicht lokal emissionsfrei betreiben, bieten laut Roland Dold, Verantwortlicher bei der Fahrzeugentwicklung von Daimler Trucks, jedoch eine vergleichsweise hohe Energiedichte. Diesel sei „der eigentlich perfekte Energieträger“, so Dold. Während Diesel-Kraftstoff für 800 Kilometer Reichweite etwa 200 Kilogramm Gewicht bedinge, komme eine vergleichbare Batterie-Lösung auf acht Tonnen.
Dold räumte ein, dass bei Batterien in den nächsten Jahren Sprünge bei der Leistungsfähigkeit, weniger Gewicht und niedrigere Preise erwartet werden. Daimler gehe aber nicht davon aus, dass dies in vernünftiger Relation von Gewicht und Reichweite im Vergleich zum Diesel stattfinden wird.
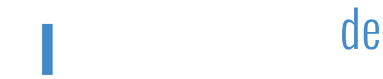

Railfriend meint
Da hier von derzeitigen 4,50 €/l PtL die Rede ist – er Preis für (importierbares) PtL wird erheblich fallen: http://www.spiegel.de/spiegel/power-to-liquid-welche-rolle-zukuenftig-biokraftstoff-spielt-a-1201812.html
Jörg meint
In dem SPIEGEL-Artikel gibt es einen Querschnitt über die aktuellen Entwicklungen alternativer Kraftstoffe.
Auf PtL bezogen ist die Aussage drin, dass, wenn mehrere Bedingungen erfüllt werden (billiger Solarstrom aus Südamerika, Ausstralien oder Arabien) der Erzeugerpreis pro kWh-Strom auf 2 Cent fallen könnte.
Zum Vergleich: In Europa liegt der Erzeugerpreis für Billig-Braunkohlestrom wohl bei ca. 3 Cent. Strom aus erneuerbaren Energien kostet aber wohl bis zu 16 Cent.
Mit diesem o.g. „2-Cent-Strom“ aus Übersee wäre dann eine PtL-Produktion hinzubekommen, so der SPIEGEL-Artikel, deren Endprodukt dann einen ähnlichen Preis hätte, wie heutiger Biokraftstoff.
Wieder zum Vergleich: der Erzeugerpreis von Biokraftstoff liegt bei ca. 1€.
Der aktuelle Erzeugerpreis von normalen Diesel/Benzin liegt aktuell wohl bei ca. 0,50€.
Damit wäre, wenn wir mal alle Abgaben außen vor lassen und zukünftig der Strom wie o.g. zu 2 Cent aus erneuerbarer Energie erzeugt werden sollte, PtL doppelt so teuer wie herkömmlicher Sprit. Wird das 2-Cent-Ziel nicht erreicht, sieht es noch schlechter für PtL aus.
Ich sehe da (außer es wird massiv regulatorisch eingegriffen) auch zukünftig keinen großen Markt für PtL.
(Oder habe ich bei den Zahlen irgendwas durcheinander gehauen?)
Railfriend meint
Bei 70 % PtL-Prozesswirkungsgrad, den sunfire angibt, und 2 cent/kWh Stromtarif betragen die Stromkosten rund 3 cent/kWh PtL, d.h. 0,3 €/l PtL. Der im link von dem Siemens-Ing. Tremel genannte, Kraftstoffpreis dürfte damit wohl erzielbar und mit dem aktuellen vergleichbar sein. Kostengünstiger PV-Strom aus Argentinien oder Nordafrika wäre hingegen schwerlich für BEV in Deutschland nutzbar, wie auch die Aufgabe des Wüstenstromprojekts gezeigt hat.
Jörg meint
Wo auch immer in (ferner?) Zukunft PtL preislich und in der Verfügbarkeit landen wird (ich hab keine Ahnung), es wird sich dann mit dann aktuellen anderen Systemen messen müssen. Ein Vergleich zwischen „PtL in ferner Zukunft“ und „aktuellen Systemen“ ist ja eher akademisch.
Aktuell liegt PtL weit hinten (Preis, Systemsicherheit, Verfügbarkeit).
Desertec ist doch am Rückzug aller Großfirmen gescheitert, die erst das Thema besetzt hatten (gab’s eigentlich Bürger-Steuer-Fördergeld?) und dann aus Angst vor der Entstehung von Konkurenz zur heimischen Energiegewinnung das Ganze wortwörtlich in den Sand gesetzt haben.
Jörg meint
Wenn ich die Tagespresse richtig verfolgt habe, dann hat Daimler überraschender Weise entdeckt, dass in ihren LKW irgendwas, softwareseitig, verbaut ist, von dem sie offenbar bisher keine Kenntnis hatten und was irgendwie die Abgasreinigung temporär auf AUS stellt.
Die kennen offenbar ihr eigenes Produkt nicht, sollten sich auf einfachere Systeme (z.B. akku + emotor) konzentrieren. Vielleicht bekommen sie diese in den Griff (?).
Anonym meint
Welch sinnfreier Kommentar…
Weil ein Akku-Management sicherlich auch deutlich einfacher zu entwicklen und programmieren ist, als eine Abgasreinigung, welche eigentlich eh immer auf „ON“ stehen sollte.
Klasse Leistung – einfach mal wieder jemand durch den Kakao ziehen ohne Argumente und ohne sich die Zeit zu nehmen 5 Minuten über den eigenen Post nachzudenken.
Jörg meint
@anonym
Ich habe da recht lange drüber nachgedacht.
DAIMLER behauptet, keine Ahnung von der Soft des eigenen Produktes zu haben.
Entweder ist das wirklich so, dann Finger weg von diesem Anbieter.
Oder es ist gelogen. Dann stellt sich mir die Frage, welche Aussagen von DAIMLER zu Thema sind vertrauenswürdig.
Meine Vermutung: die wissen recht genau, was sie einbauen.
Deshalb mein persönlicher Schluss: ich traue deren Aussagen nicht. Schon garnicht zu Themen, die in Konkurenz zu ihrem angestammten Geschäftsmodell stehen (z.B. „… 800km Reichweite … 8to Batterie…“)
E-nthusiast meint
Beeindruckend, wie Railfriend hier die Diskussion ganz klar gegen mindestens 6 Fanatiker gewinnt – er ist halt der Einzige mit Fakten und Argumenten. Bravo! Die bisher beste Diskussion hier.
Fritz! meint
Dann haben Sie seine Fakten aber nicht gelesen.
Railfriend meint
@Fritz! schreibt: „Bei einem Akku gehen max. 10 % verloren, inkl. Wandlerverlusten.“ Nun ja, da fehlen noch Motor, Heizung, Schnellader, Netz usw.
Die im ecomento-Forum bereits bekannte Studie kommt daher zu genaueren Ergebnissen:
https://www.researchgate.net/publication/325344062_Mobility_from_Renewable_Electricity_Infrastructure_Comparison_for_Battery_and_Hydrogen_Fuel_Cell_Vehicles
Die Stromverluste einschließlich anteiliger Stromspeicherung zur Überbrückung volatiler Angebot-Nachfrageschwankungen und kalter Dunkelflauten sind leider viel größer als mancher Fan meint.
Auch meinen Hinweis auf den EE-Anlagen-Rohstoffaufwandfaktor 2 bis 3 zwischen deutscher und internationaler WEA/PV-Stromproduktion möchte hier niemand wahrhaben und man klammert sich allein an den Wirkungsgrad fest. Vergleichbare Aussagen findet man auch in der „bösen“ neuesten verlinkten Prognos-Studie.
Danke @E-nthusiast.
Railfriend meint
Danke, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Meine geposteten Kommentare und Antworten verschwinden hier manchmal kommentarlos. So auch der letzte mit interessanten links.
Jörg meint
Sich gegenseitig Studien (teilweise finanziert von parteilichen Diskursteilnehmern) um die Ohren zu hauen, blendet zwei Dinge aus:
Für viele Privatleute ist ein PKW-Kauf, in den Grenzen ihres Budgets, eine emotionale Bauch- manchmal auch Notentscheidung. In der Regel wird hierzu keine Studien herangezogen.
Die Frachtführer (also LKW-Sektor) entscheiden nach dem Ergebnis des Taschenrechners: „Was kostet mich das Ganze über die gesamte Laufzeit (Anschaffung, Betriebskosten, Instandhaltung, Wiederverkauf …) und mit welcher, der gleich kostengünstigenden Lösungen, bleibe ich am flexibelsten (Wechsel des „Kraftstoff“-Anbieters, „Tankstellen“-Netz).“ Hier wird dann schon eher mal eine Studie herangezogen. Allerdings eine, die den kaufmännischen IST-Zustand beschreibt und nicht ingenieurlastige Laborplanungen hochjubelt.
Railfriend meint
@Jörg, bitte erklären Sie, was Sie mit @Railfriend(s?) meinen. Zu den 4,50 €/l PtL finden Sie oben eine anderslautende Aussage. Aber vielleicht können Sie auch hier weder nachweisen, dass der im link genannte Siemens-Ing. Tremel in Wahrheit für die Ölindustrie arbeitet…
Railfriend meint
Das Potential synthetischer Kraftstoffe ist laut neuester Prognos-Studie sehr groß und widerlegt die Angaben von @volsor, die er aus dem TFF Forum kopiert hatte;
http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-E_Fuels_sichern_Erreichen_Klimaziele_Prognos_Studie_neuen_fluessigen_Energietraegern_FOTO-8635374
Fritz! meint
Alleine der Ansatz (alle flüssigen Energieträger sollen gefälligst auch durch flüssige Energieträger ersetzt werden) ist schon falsch, wie soll da ein brauchbares Ergebniss bei rauskommen? Beim Verkehr sollen die flüssigen Energieträger mit dem grottigen Wirkungsgrad eben durch elektrische Energieträger mit einem sehr hohen Wirkungsgrad ersetzt werden und nicht durch PtL. Wir wollen doch nicht den miesen Zustand weiter konservieren, sondern die Fortbewegung verbessern/effizienter/sauberer/leiser/CO2-freier machen!
Ebenso schreibt der Bericht ja selbst von massenhaften Vernichtung von Energie bei PtL. Um 550 PetaJoule PtL Energie zu erzeugen, werden 2.000 Petajoule an Energie benötigt. Also Faktor 4 mehr. Dreiviertel der Energie geht verloren/ist nicht nutzbar. Super Wirkungsgrad!
Bei einem Akku gehen max. 10 % verloren, inkl. Wandlerverlusten. Desweiteren bleiben alle Nachteile flüssiger Energieträger erhalten:
kein laden/tanken zuhause möglich,
Fahrt zur Tankstelle weiter zwingend nötig,
Abhängigkeit von Großkonzernen beim Energieträger (Strom kann ich mit PV komplett autark herstellen),
es wird weiter verbrannt mit (wenn auch weniger) Giftstoffen aus dem Auspuff,
die Fahrzeuge machen weiter Lärm,
die Tankstellen müssen weiter mit Tanklastern beliefert werden (mehr LKW-Verkehr),
…
Auch wurde die Studie von Ölfirmen bezahlt (wes Brot ich eß, des Lied ich sing), somit also mit viel Vorsicht zu geniesen.
Railfriend meint
Dena prognostirziert etwa das Gleiche. „«Das ist keine Science-Fiction», sagte Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann. Selbst wenn sich batteriebetriebene Elektroautos in den kommenden Jahren durchsetzten, würden nach dem Szenario der Studie im Jahr 2050 mehr als 70 Prozent des Energiebedarfs aller Verkehrträger in der EU durch E-Fuels gedeckt. Der größte Teil werde dabei für den Flug-, Schiffs- und Straßengüterverkehr benötigt.“
https://www.konstanz.ihk.de/blob/knihk24/innovation/umweltberatung/downloads/3922380/75268e3466bd5210ab65ec6e31fb7c66/ECO-Post_Dezember_2017-data.pdf
Jörg meint
Diese Studie wurde erstellt im Auftrag von? Na? 3x raten?
RICHTIG! Im Auftrag des VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.)
@Railfriend
DEN Halbsatz hätest Du doch hier noch mit reinkopieren können! Vollständig ist im Artikel über die Studie zu lesen:
„… Selbst wenn sich batterieelektrische Fahrzeuge in der Masse stark durchsetzen, werden in Europa 70 Prozent des Energiebedarfs im Verkehr über E-Fuels gedeckt, so die im Auftrag des VDA erstellte Studie. …“
Mit dieser selektiven Wiedergabe disqualifizierst Du Dich.
Railfriend meint
@Jörg, Sie meinen also, Dena und Prognos lügen hier etwas vor. Bitte, dann widerlegen Sie hier deren Aussagen.
Jörg meint
@Railfriend(s?)
Netter Versuch ;-)
Wo habe ich geschrieben, dass DENA etc. etwas vorlügen („lügen“ im Sinne einer wissentlichen Falschaussage)?
Zur Vollständigkeit des Hinweises auf eine Studie (Ihr Link führt allerdings nicht zu Studie selbst, sondern zur Pressemitteilung des Durchführenden über diese Studie) gehört, dass der zahlende Auftraggeber genannt wird. Nur wenn die Interessenslagen hinter der Studie erkennbar sind, ist deren Wert auch einschätzbar.
(Wer diese Interessenslage verschweigt, muss gefallen lassen, entweder als parteiisch oder als laienhaft eingestuft zu werden.)
Danach kann man(n) noch gern in die Studienstruktur einsteigen, die, das wissen zumindest alle die selbst bereits Studien konzipiert haben, entscheidend für das Studienergebnis ist.
Railfriend meint
@Fritz!, Sie lesen nicht: Bei PtL entsteht nahezu kein Feinstaub und PHEV bremsen ebenso abriebfrei elektrisch wie BEV. Das „geringe“ Mehrgewicht des BEV ist bei halbwegs vergleichbarer Reichweite allerdings erheblich. Tatsächlich gering ist hingegen die Reifenkmlebensdauer eines rollwiderstandoptimierten BMW I3…
Railfriend meint
@Jörg, richtig, Auftraggeber ist in beiden Fällen der VDA. Ich traue renomierten Instituten wie Prognos oder der Dena dennoch zu, halbwegs objektive Studien zu erstellen. Gerne dürfen Sie aber erläutern, wo deren Aussagen falsch sein sollen.
Jörg meint
@Railfriend(s?)
Ahhh, JETZT verstehe ich das!
Wir gehen offenbar von unterschiedlichen Definitionen zur „Studie“ aus.
Für mich ist eine (solche) Studie die wissenschaftliche Beantwortung einer Fragestellung. Objektivität kann es nur im Rahmen der Fragestellung und des Studienaufbaues geben.
Sie scheinen eher der Meinung zu sein, dass eine Studie auch außerhalb dieser Rahmenssetzung objektiv ist (?) so im Sinne von „hier wird ein Naturgesetz entdeckt“. Wenn ja, dies ist ein Trugschluss.
Eine „richtig“ gemachte Studie (so sie denn veröffentlicht wird), wird die Handschrift des Auftraggebers tragen und in sich stimmig sein (also auch im Rahmen der Fragestellung und der Ausgangsdaten und -grenzen nicht widerlegbar). In diesem kleinen Betrachtungskosmos ist sie also richtig.
Das bedeutet aber nicht, dass, wenn man den Betrachtungswinkel aufzieht, die Studienergebnisse im größeren Rahmen automatisch irgendwelchen Sinn ergeben.
Sie sollten sich mit Studienarchitektur beschäftigen. Dann wird das für Sie vielleicht klarer.
Die veröffentlichte Zusammenfassung der DENA-Studie zeigt (für mich deutlich) deren Zielstellung.
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2017/2017Q4/E-Fuels-Studie_deutsche_Zusammenfassung.pdf
Seite 5 listet den erkannten „Handlungsbedarf“ in drei Punkten auf. In jedem der Punkte geht es letztendlich um gewünschte Eingriffe der Politik zur Schaffung unterstützender Rahmenbedingungen. Für mich liest sich das wie: „… Politiker, nehmt Steuergelder vom Bürger, macht daraus Fördergelder für uns …“
Im Übrigen entscheidet der Markt. Wenn den der E-Fuels aktuell Kosten in Höhe von 4,50€ pro Liter Dieseläquivalent kostet, dann ist es noch ein langer Weg bis zum Markt. Sollten die 4,50€ ohne jegliche Steuer und Abgabe sein, dann wäre die aktuelle Zielgröße wohl bei 0,60€ (?)
Fritz! meint
Auch beim Gewicht wäre es besser, wenn Sie ein wenig mehr Zeit in Ihrer Recherche investieren würden. Gewicht aktuelle E-Autos gegen Mitbewerber mit Verbrenner-Motor:
Tesla Model 3 (EPA-Reichweite 350 bis 500 km, also real erreichbar)
1.610 bis 1.730 kg
BMW 3er
1.475 bis 1.855 kg
Audi A4
1.480 bis 1.735 kg
Mercedes C-Klasse
1.450 bis 1.870 kg
Also quasi identisches Gewicht, demnach KEIN erhöhter Reifenabrieb durch Mehrgewicht.
Jörg meint
@railfriens
Alle Studien und Diskussionen zum CO2-Rucksack kranken daran (so mein Eindruck), dass jeder Diskutant den zu betrachtenden Gesamtprozess in seinem Interesse definiert. Manche Dinge werden in die Betrachtung hereingenommen, andere herausgelassen um dann am Ende allerdings für den zusammengefriemelten, zu betrachtenden Prozess sowieso keine belastbaren Daten zu haben.
Was bleibt ist das Bauchgefühl, pseudowissenschaftlich hinterlegt.
Letztendlich geht es bei der CO2-Betrachtung um die Vermeidung der weiteren Erderwärmung. Bei Fahrzeugen, die keinerlei fossile Brennstoffe mehr benötigen, ist diese CO2-Betrachtung vielleicht nicht mehr zielführend. Vielmehr müsste hier vielleicht die Energieeffizens des Gesamtprozesses untersucht werden. Mindereffizente Prozesse setzen vielleicht sehr viel Abwärme frei (s. Erderwärmung), effizenter vielleicht nicht. Die Prozesskette Strom -> PtL -> Strom ist tendenziell ineffektiver als als Strom -> Strom.
Ich versteh ja, dass Sie PtL als smarte Lösung für das Lager- und Transportproblem von Energie verstehen. Bei DER Effizens bei der Herstellung gruselt es mich aber. Hinzu kommt, dass das Antriebskonzept „Verbrennungsmotor“ weiter genutz wird mit solchen Nebenzweigen wie: Motorenölproduktion, hoher technischer Aufwand für den Gesamtantriebsstrang, vergleichsweise kurze Wartungsintervalle ….. Das alles müsste man wohl in die Betrachtung „Was führt zu einer stärkeren Aufheizung?“ mit einbeziehen. Der Transport des „2-Cent-PtL“ aus z.B. Australien nach Zentraleuropa ist da noch garnicht betrachtet (Bau, Wartung und Instandhaltung entsprechender Verlade- und Transportinfrastruktur…)
Railfriend meint
@Fritz!, keine Ahnung, ob meine Antwort zu Ihrem Pkw-Vergleich hier richtig platziert ist, aber es gibt sonst nirgends eine Antwortmöglichkeit. Nicht vergleichbar sind jedenfalls die Tankreichweiten, was ich in meinem Kommentar ausdrücklich voraussetzte. Durchschnittliche Dieselmodelle kommen bekanntlich auf 1000 km Tesla bei weitem nicht. Sie wissen das selbst, versuchen es aber trotzdem.
Jörg meint
Durchschnittliche Dieselmodelle kommen hoffentlich auf 200.000km und mehr.
Dann sind sie zwar noch weit weg von den TESLAs, die schon 600.000km auf der Uhr haben, aber für ein Autoleben wirds reichen.
Railfriend meint
@Jörg, Sie wissen, bei BEV steigen mit der Reichweite nicht nur Kosten und Fahrzeugmasse an, sondern auch der CO2-Rucksack wird immer schwerer. Das gilt auch für eine Batterieproduktion auf PV-Strombasis und deren CO2-Rucksack. Die Kraftstofftankgröße = Reichweite eines Verbrenners beeinflusst hingegen weder die Kosten noch die Fahrzeugmasse noch den CO2-Rucksack nennenswert.
Ihr Vergleich zwischen Tankreichweite und Lebensdauer-Kilometerleistung führt nicht weiter, zumal auch Diesel nachweislich 500.000 km halten können. Davon abgesehen ist Reichweitenkönig Tesla allein schon von den Anschaffungskosten her nicht mit einem durchschnittlichen Diesel vergleichbar, den sich ein Durchschnittsbürger leisten kann. Bezahlbare BEV haben nicht einmal die halbe Reichweite von Verbrennern oder z.B. PHEV wie ein Nissan Note E-Power. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Allrounder mit fossilem Verbrennungsmotor haben trotz Reichweite keine Zukunft, wohl aber sparsame PHEV mit PtL oder anderen EE-Synfuels im Tank.
Um Allrounder durch BEV zu ersetzen müssen Batterien nicht nur viel leichter, billiger, zyklenfester, schnelladefähiger usw. werden, sondern Strom- und Ladeinfrastruktur müssen dann für Leistungen ausgelegt sein, die z.B. jede AB-Raststätte zur MW-Anlage mit Umspannwerk und Hochspannungstrasse macht. Mit Gewalt geht auch das, wie die Bahnstromversorgung zeigt. Wobei hier noch der Unterschied hinzu kommt, dass die Bahn nur ein Zehntel der Pkm des Straßenverkehrs leistet und dazu je Pkm nur einen Bruchteil von dessen Fahrenergie benötigt. Ich halte daher solchen Infrastrukturaufwand für ein Auslaufmodell.
alupo meint
Ich denke, dass am Akku vielleich gerade einmal intensiv 10 bis 20 Jahre intensiver geforscht wurde. Vorher gab es doch auch überhaupt keinen Fortschritt.
Wenn man also die Entdeckung der Technologie als Kriterium heranzieht um daraus eine Forschungsdauer zu bestimmen sollte man korrekterweise beim Akku auf die Babylonier zurückgehen, denn diese hatten zumindest schon dir Batteriezelle (für elektrochemische Prozesse an Metallen).
Um zu beurteilen wie intensiv wann darüber geforscht wurde müsste man wohl eher die kumulierten Forschungsausgaben vergleichen. Und da liegt der Verbrennungsmotor sicherlich in Führung, noch.
Wenn man das geographisch unterscheiden würde käme man wohl zum Schluß, dass die Europäer fast alle ihre Forschungsgelder in die Verbrennertechnologie gesteckt haben. Bei den Asiaten könnte schon fast die Akkutechnologie kostenmäßig führend sein (oder zumindest sind sie diejenigen, die mit China, Südkorea und Japan als erstes massiv darüber geforscht haben) und die Amerikaner liegen gerade vermutlich irgendwo mitten drin mit Ford, Chrysler, GM und Tesla.
Leonardo meint
…..Während Diesel-Kraftstoff für 800 Kilometer Reichweite etwa 200 Kilogramm Gewicht bedinge, komme eine vergleichbare Batterie-Lösung auf acht Tonnen……
Ein LKW Fahrer (bei 2 Fahrern sieht es anders aus) darf nur 4,5 Std am Stück fahren, das sind im Idealfall bei erlaubten 80 km/h so um die 360 km dann wird der Akku während der Pause geladen. Es reicht also eine Batterie mit 4 Tonnen.
Der E-LKW braucht keinen Auspuff, Kupplung, aufwendiges Getriebe, Abgasreinigungslabor, Dieseltank, Add-Blue Tank, …..
Ich denke daß aus den 4 Tonnen im Endeffekt nur 2 Tonnen Mehrgewicht im Vergleich zum Diesel zu veranschlagen sind.
Fritz! meint
Es ist sogar noch weniger, der Tesla Semi Truck wird als Zugmaschine dasselbe zul. Zuladung für den Auflieger haben wie ein Diesel-LKW. Es geht also auch ohne Zusatzgewicht.
Anonym meint
@Leonardo
„dann wird der Akku während der Pause geladen.“
Welch romantische Sicht – die aber völlig an der Realität vorbei geht.
Schau dir doch mal Abends, am Wochenende oder an Feiertagen an, wo die Lkws alle stehen um ihre Pausen und Ruhezeiten zu machen.
Auf der Autobahn stehen die Teilweise mit Warnblinkern bereits auf der Auffahrt zu den Rastplätzen. Weil die „offiziellen“ Rastplätze schon seit Jahren überfüllt sind, parken viele schon Innerorts oder in irgendwelchen Industriegebieten.
Mit anderen Worten: Wir haben nicht mal genug Parkplätze für den Lkw-Bestand der auf unseren Straßen unterwegs ist (und Jahr um Jahr zunimmt). Wie wollen wir es dann schaffen, die Ladeinfrastruktur dafür bereit zu stellen. Im Gegensatz zum Pkw kann/darf der Lkw-Fahrer nämlich nach Beendigung des Ladevorgangs aller Wahrscheinlichkeit seinen Lkw nicht mehr umparken und die Ladesäule „frei machen“ weil dann seine Lenkzeiten überschritten sind!
Das bedeutet jeder Stellplatz müsst eine eigene Ladesäule bekommen!
Viel Vergnügen dabei, dafür einen Sponsor zu bekommen! In einer Branche mit Dumpinglöhnen und maximal tiefen Betriebskosten. Da wird sich kein Spediteur finden lassen, der das Risiko eingeht an einer fremden Ladesäule weit über 1€ für die KWh oder die Zeitdfauer zu zahlen!
Und es wird auch keinen Anbieter geben, der einen kompletten Rastpaltz mit 100 Ladesäulen á 10.000€ (bei Lkw-Batterieleistung wahrscheinlich noch mehr) hinstellt und dann den Strom zum Selbstkostenpreis oder zumidnest um die 25 Cent oder drunter anzubieten!
Jörg meint
@anonym
Ein Teil des Ladeproblems löst sich allein dadurch, wenn man(n) bedenkt, dass ein Großteil der LKW auf der Strasse halt nicht die Vagabunden sind, die nachts und am Wochenende auf den AB-Rastplätzen stehen.
Viele LKW sind entweder auf festen Kurzrouten unterwegs (GVZ – GVZ) und haben an den End- und Zwischenpunkten genug Zeit (= Zwangsruhepause) und Raum (= Betriebshof) um geladen zu werden oder sie fahren „nur“ um den Kirchturm uns sind regelmäßig (z.B. nachts) auf dem Betriebshof des Frachtführers.
Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind die aktuellen SEMI-Vorbesteller und -Mitentwickler eher nicht im Vagabunden-Ladungsgeschäft und bieten mit ihren Betriebshöfen und Fahrstrecken ideale Voraussetzungen für den SEMI.
nilsbär meint
Wenn der Tesla Semi einigermaßen hält, was Musk verspricht, werden auch schwere LKW bald elektrisch fahren. Die Batterie des Semi wiegt vielleicht 4 Tonnen. Was aber bei einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 36 t im Verhältnis sogar weniger ist als bei einem vollbeladenen E-PKW. Verständlich (aber dumm), dass da Diesel-Daimler den Kopf in den Sand steckt. Und die H2-Brennstoffzelle ist wirtschaftlicher Unsinn. Warum Strom zur Herstellung von Wasserstoff verwenden und aus diesem in einer Brennstoffzelle wieder Strom erzeugen (mit 2x Umwandlungsverlust) wenn Strom fast verlustfrei in Autobatterien gespeichert werden kann? Selbst wenn in Jahrzehnten Strom aus erneuerbaren Quellen im Überfluss zur Verfügung stehen sollte, wird man eben damit E-Autos günstig oder gratis laden.
Railfriend meint
Der Dieselantrieb verfügt noch über einiges Entwicklungspotential. Mit sauberem PtL-Kraftstoff kann der Wirkungsgrad auf über 50 % angehoben werden. Weiteres Potential bieten marktreife Abwärmetechnologien wie ORC oder TEG. IAV entwickelt z.B. kompakte ORC-Aggregate mit 12 kW Leistung für Lkw-Motoren, deren Mehrkosten bereits nach zwei Jahren wieder eingefahren werden.
Landmark M3 meint
Ein Entwicklungspotenzial beim Dieselmotor sehe ich nicht.
Was helfen könnte, die LKW nicht mehr die Aerodynamik einer Schrankwand zu verpassen, denn jeder Liter der da gespart wird, muss nicht mit teuer Technik erkauft werden. Nur so ein Gedanke.
Railfriend meint
Sie sehen es nicht oder wissen Sie nichts darüber ?
Landmark M3 meint
Dem Diesel sind von der Physik klare Grenzen gesetzt, es wurde versucht sich dieser Grenze so weit als möglich zu nähern, aber, es gibt keine Wunder die den Diesel über diese Grenzen hinweg schreiten lassen.
„Saubere Kraftstoffe“ werden verbrannt und es kommen dann giftige Abgase hinten raus. Wo kommen denn die „sauberen Kraftstoffe“ her? Wie ist deren Energieeffizienz? Wie hoch sind deren Kosten.
Energie aus der Abwärme nutzbar zu machen ist auf jeden Fall sinnvoll, wird ja bei Schiffen schon genutzt.
Railfriend meint
Bevor Sie hier weiter raten und Falsches verbreiten googlen Sie bitte nach Ptl=Power to Liquid.
volsor meint
Hier ein Beitrag aus dem TFF Forum:
„Power to Liquid (PtL) – Wirkungsgrad und Strombedarf“
von CarstenM » 21. Nov 2017, 09:42
„Der Artikel in AutoBild Nr. 46 vom 17.11.2017 greift eine Studie von PwC auf, der Redakteur hat die Zahlen also nicht selbst ermittelt. Leider wird nicht genannt, von wann die Studie ist oder womit sie sich genau befasst. Es wird nur berichtet, dass PwC die CO2-neutralen Alternativen [zu Diesel und Benzin] aus ökologischer Sicht betrachtet. Diese Alternativen sind: Li-Ion-Batterie, Brennstoffzellen mit Wasserstoff aus Elektrolyse, synthetischer Kraftoff (aus Wasserstoff gewonnenes Methanol).
Die Kernthese des Artikels lautet: Antrieb der Zukunft – darum kommt die Batterie
1. Weil wir weniger Windräder brauchen [um den zusätzlichen Strom für die neuen Verbraucher zu erzeugen, Anm. von mir] – BEV +34%, FCEV +66%, PtL +206%
Der zusätzliche Energiebedarf in TWh wird dann noch umgerechnet in „Anzahl der zusätzlich benötigen Windräder“.
Hier fehlt anscheinend der Aspekt, dass wir bereits jetzt mehr Energie produzieren, als wir benötigen. Außerdem fehlt mir, dass alle drei Alternativen dazu geeignet sind, Produktionsspitzen aufzufangen und dies ebenfalls zu einem geringeren Zubau führt. Hier wäre es spannend, die Studie zu lesen, um zu sehen, ob das eingeflossen ist oder nicht.
2. Weil die Energieversorger weniger in Produktionskapazitäten und Infrastruktur investieren müssen.
Hier geht es um Pufferspeicher, Ladesäulen, Elektrolyseure, H2-Tankstellen, Fabriken für synthetischen Kraftstoff und neue Kraftwerke.
BEV +301 Mrd., FCEV +479 Mrd., PtL +1371 Mrd. €
3. weil sie am effizientesten arbeitet.
Hier geht es um die Energieverluste nach der Stromerzeugung, und zwar über Produktion und Speicherung, Verteilung und Einspeisung und den Antriebsstrang.
Ergebnis: BEV 70% Gesamtwirkungsgrad, FCEV 36%, PtL 11%(!)
Schade, dass zum Vergleich nicht der W2W-Wirkungsgrad eines Diesel oder Benziners genannt wird.
4. Weil sie für Autofahrer im Betrieb am günstigsten ist.
PwC hat hier in die Energiepreise auch Investitionen(welche?), Steuern und Gewinnmargen eingerechnet.
Erwartete „Kraftstoffkosten“ in € pro 100 km: BEV 5-7 €, FCEV 7-11€, PtL 18-26€, Benzin/Diesel 7-12€
Natürlich sind diese Informationen sehr oberflächlich. Für die Zielgruppe einer unterhaltenden Zeitschrift – nicht zu verwechseln mit einer Fachzeitschrift – ist die Darstellung mit viele Grafiken aber gut. Die Stammtischargumente von VDA & Co., nach denen der Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen die Superdupernonplusultralösung für die Zukunft ist, stehen damit ziemlich nackt da.“
Railfriend meint
@volsor, wir hatten diese Diskussion hier und im Klimaretter-Forum schon und möchte nicht alles wiederholen. Ein zukünftiger Pkw (PHEV) oder alter Audi A2/VW Lupo mit 3 l/100 km Verbrauch und PtL für 2 €/l kostet 6 €/100 km. Die Produktionskosten für PtL fallen bis auf 0,50 €/l ab. Ihre Info weicht davon erheblich ab: „PtL 18-26€, Benzin/Diesel 7-12€“.
Ich gebe Ihnen Recht: „Natürlich sind diese Informationen sehr oberflächlich.“
Landmark M3 meint
Ach ja, was ist da falsch. Bei einer Verbrennung werden also keine giftigen Abgase erzeugt. Aus viel Energie wird sehr wenig Energie gemacht.
Na ja, wenn Sie meinen das das nicht stimmt, dann los widerlegen Sie es.
Railfriend meint
@Landmark M3, da Sie über PtL/Emissionen urteilen ohne davon zu wissen:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180426_OTS0229/e-fuels-sollen-benzin-und-diesel-aus-den-autotanks-verdraengen
http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/auto-kuenstliche-oeko-kraftstoffe-was-dieselt-denn-da-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170814-99-639196
Fritz! meint
Das mit dem widerlegen wird schwierig, ohne einige Grundsätze in der Physik zu mißachten. Aber das Kleinkind im weißen Haus kann das, warum nicht auch hier…?
alupo meint
Eine heiße Oxidation, d.h. eine Verbrennung verursacht immer unzählige Nebenprodukte, wovon wir bisher nur die allerwenigsten betrachten.
Wenn wir das NOx Problem gelöst hätten gibt es mindestens noch ein weiteres Dutzend hochgiftiger Stoffe aus einer Verbrennung.
Soviele verschiedene Abgasreinigungsfabriken passen gar nicht auf einen LKW, zumindest wenn man es ordentlich machen will, d.h. einmal ohne Abschalteinrichtungen und ohne jede vermeintliche Gesetzeslücke aggressiv auszunutzen.
Fritz! meint
Warum soll ich ein sehr sehr schlechtes Verfahren zur Erzeugung von Bewegungsenergie (Diesel) durch ein (nur) sehr schlechtes Verfahren (PtL) ersetzen, wo doch ein gutes Verfahren (Akku & E-Motor) bereits marktreif vorhanden ist (und ab 2019 gekauft werden kann)? Nur weil Daimler dabei über keinerlei Expertenwissen verfügt? Dieser Zwischenschritt hat überhaupt keinen Sinn, außer Erhalt der Abhängigkeit der Verbraucher von Tankstellen, jährlichen kostenpflichtigen Inspektionen ihrer Verbrenner-Motoren, hohem Lärmpegel der Verbrenner-Motoren, … (Rest siehe oben)
one.second meint
Die Wirkungsgrade für die von Ihnen angesprochenen Technologien sind immer noch viel zu schlecht und da sind auch keine großen Sprünge zu erwarten. Ich denke, der Tesla-Semi wird Daimler kalt erwischen, und dann hat es sich ausgedieselt. Der Wirkungsgrad bei batterielektrischen Fahrzeugen ist einfach viel höher und auch das Zusatzgewicht ist durch die Möglichkeit der Rekuperation fast bedeutungslos. Im Gegensatz zu gewissen Stimmen aus der deutschen Autoindustrie sind die Spezifikationen des Tesla-Semi ausgezeichnet mit der Physik vereinbar, und es wahrscheinlich, dass Tesla auch die eigenen Preisvorstellungen umsetzen kann, da sie sowohl in der Batteriechemie als auch in der Massenproduktion mit ihrer Gigafabrik führend sind.
Railfriend meint
Sie blenden die Wirkungsgradkette der BEV-Stromversorgung mit volatilem EE-Stromangebot, anteilig notwendiger Stromspeicherung, Schnelladestationen usw. aus. Ferner den Energiemehrbedarf und zusätzlichen Reifenfeinstaub schwerer Fahrzeuge, insbesondere im Fernstreckentransport.
Desweiteren kann der EE-Anlagen-Rohstoffbedarf eines PtL-Betriebs sogar geringer sein als bei inländischer BEV-EE-Stomversorgung, da EE-Anlagen für PtL-Produktion außerhalb Deutschlands die zwei- bis dreifache Strommenge produzieren können: Ein Irrtum, zu meinen, es komme allein auf den Wirkungsgrad an.
Fritz! meint
Was reden Sie dann da? Der PtL LKW schwebt also und der Batterie-LKW erzeugt Reifenabrieb? Warum erzeugt Ihr uneffktiver PtL-LKW keinen Reifenabrieb? Und Ihre Wirkungsgrad-Kette beim E-Antrieb erwischt natürlich die PtL-Kette nicht, da die ja komplett ohne Strom auskommt? Die macht das mit Luft & Liebe? Der Batterie-LKW ist nicht schwerer als ein Diesel oder PtL-LKW, siehe Tesla Semi. Nur weil das Mercedes nicht hinbekommt, heißt das noch lange nicht, daß es stimmt.
Railfriend meint
Meine längere Antwort ist nach dem posting leider verschwunden. Daher nur kurz: Der Wirkungsgrad des BEV ist einschließlich anteilig notwendiger Stromspeicherung des volatilen Stromangebots und Schnelladen geringer als gedacht. Desweiteren ist der Rohstoffaufwand für die Inland EE-Stromversorgung der BEV zu beachten, denn PtL kann mit 2-3-fach produktiveren EE-Anlagen außerhalb Deutschlands produziert werden. Ein Irrtum zu meinen, allein der Wirkungsgrad wäre entscheidend.
alupo meint
Dann haben Sie, Railfriend, zu Hause sicher vorwiegend Elektrogeräte mit der Energieeinstufung „E“.
Der Wirkungsgrad ist ja laut Ihrem Kommentar nicht so wichtig, insbesondere bei so grossen Energieverbrauchern wie Autos.
Sorry, ich denke das kann niemand nachvollziehen. Auch nicht mit dem Geldbeutel.
Raolfriend meint
@Alupo, Denken Sie über den Faktor 2-3 noch mal in Ruhe nach.
Railfriend meint
@Fritz!, bitte lesen Sie etwas sorgfältiger. Trauriger Fakt ist bislang, dass BEV immer schwerer sind als Verbrenner (trotz deutlich geringerer Reichweite) und daher zwangsläufig mehr Feinstaub aus Straßen/Reifenabrieb produzieren. Dieser macht bekanntlich 85 % der straßenverkehrsbedingten Feinstaubemission aus. Daran ändert eine Umstellung auf E-Mobilität also fast nichts.
Fritz! meint
@railfriend Dann sollten Sie aber auch mal besser recherchieren.
Es mögen zwar (durch das leicht höhere Gewicht eine E-Autos) 3 bis 15 % mehr Reifenabrieb entstehen, dafür durch Rekuperation aber auch ca. 80% weniger Bremsstaub. Desweiteren ist diese Art von Feinstaub unkritisch, da sie nicht lungengängig ist und die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann. Ganz im Gegensatz zu dem Feinstaub, der von Diesel und Benzin-Direkteinspritzer und PtL-Verbrennern erzeugt wird.
Railfriend meint
@Fritz!, Sie lesen nicht: Bei PtL entsteht nahezu kein Feinstaub und PHEV bremsen ebenso abriebfrei elektrisch wie BEV. Das „geringe“ Mehrgewicht des BEV ist bei halbwegs vergleichbarer Reichweite allerdings erheblich. Tatsächlich gering ist hingegen die Reifenkmlebensdauer eines rollwiderstandoptimierten BMW I3…
Mini-Fan meint
Ein Lkw im Fernverkehr fährt sehr lange Strecken bei konstanten Geschwindigkeiten. Da ist nichts mit Rekuperation. Außer bei Gefällstrecken auf der BAB.
Und die gewonnene Energie würde an der nächsten langen Steigung durch das höhere Leergewicht (Akkus) wieder aufgezehrt. Denn auch die Rollreibung erhöht sich bei einem erhöhten Gewicht bzw. Ladung.
Wie im Bericht steht: Daimler hat es durchgerechnet, beim Lkw lohnt sich ein Hybrid nicht.
Anders sieht es meiner Meinung nach im Stop-and-go-Verkehr, im Stadtverkehr, also bei Leicht-Lkw, aus.
Railfriend meint
Da wäre ich mir nicht so sicher. Rekuperation für jeweils 10 Min Gefälle/Steigungsfahrt auf vielen BAB erfordert keine schwere Batterie, kann nennenswert Kraftstoff einsparen und die Tankreichweite vergrößern.
Für Bahnantriebe gibt es das schon:
https://www.mtu-online.com/mtu/anwendungen/hybrid/index.de.html
nilsbär meint
@railfriend
Diese (aus Ihrer Sicht) tollen Entwicklungsperspektiven der LKW-Diesel werden die vielen von Lärm und Abgasen belasteten Menschen entlang der LKW-Routen eventuell nicht ganz würdigen können:-)
Railfriend meint
PtL hat eine viel größere Cetanzahl als fossiler Dieselkraftstoff. Daher wird die Schallemission geringer sein, zumal bei Lkw ohnehin die Abrollgeräusche dominieren. Dass auch der Schadstoffausstoß erheblich sinkt wird auch die Anwohner entlasten. Ich gebe Ihnen allerdings darin Recht, dass viel zu viele überflüssige Güter über die Straße transportiert werden. Doch hat das nichts mit der Antriebsart zu tun.
Fritz! meint
Oh, super, nicht mehr tierisch mega laut, sondern nur noch tierisch laut.
Es bleibt ein Verbrennungsprozeß, der sicherlich sauberer als einige andere ablaufen wird, aber immer noch einen ganzen Haufen giftigen Dreck hinten raushaut.
Lewellyn meint
Bei Daimler wiegt die Batterie 8 Tonnen. Bei Tesla nicht mal 4. Und dann müssen wir noch Getriebe, Abgasreinigung und Motor gegenrechnen.
Bei Daimler wiegt ja auch die 70kWh-Batterie vom EQC über 600kg.
Der 75kWh-Akku im Model3 unter 500kg.
So ist das halt, wenn man technisch hinterher hinkt.
Rainer Zufall meint
Gewichtsdelta kommend aus der Zelltechnologie oder weil die Batterie des einen mehr Strukturaufgaben übernimmt wie die des anderen?! Also ehrliche Frage, ich kenne den Gewichtsunterschied zwischen den Zelltechnologieen nicht, bzw, erwarte nicht dass die Unterschiede so eklatant sind, ausser man kann die Rundzellen des Teslas besser pressen wie die Pakete wie sie die anderen nutzen.
150kW meint
Die Chemie der Tesla Rundzellen ist auf Kapazität optimiert. Zu lasten des Ladestroms. Bei anderen Herstellern die eher Kleinwagen bauen war es bisher anders herum.
Ebenso ist z.B. beim Model 3 alles nicht reparierfähig vergossen. Das spart auch eine Menge Platz. Mit dem Nachteil das man den Akku entsorgen muss wenn er intern einen defekt hat.
Fritz! meint
Die Details fehlen noch, aber die Aussage von Tesla ist, daß der Semi dieselbe Anhängelast haben wird wie ein Diesel-LKW, also selbes Gewicht der Zugmaschine (da auch in den USA das zul. Gesamtgewicht relevant ist).
Tesla scheint es hinbekommen zu haben, die Details werden sicherlich nächstes Jahr folgen. Und bei technischen Angaben hat Tesla/Elon Musk noch nie gelogen. Sie waren oft sogar besser als angekündigt (allerdings auch oft später). Warum Mercedes es nicht hinbekommt, wissen nur sie selbst.
Landmark M3 meint
Ich denke nicht, dass es so sehr eine Frage des Könnens ist, viel mehr frage ich mich, warum wollen die nicht.
Ansonsten stimme ich Dir zu. Der eine kann und will und der andere, na ja ….. ;-)
Peter W. meint
Seltsame Aussage: Ein Hybrid ist unwirtschaftlich, aber der Wasserstoffantrieb soll sich rechnen?
Mein Vorschlag: Für die nächsten 5 bis 10 Jahre, in denen 800 kWh-Akkus noch zu schwer und teuer sind, wäre ein 2 bis 3 Liter Diesel-Rex mit 100 kWh-Akku für einen 40 Tonner eventuell eine gute Lösung. Dann könnte der Dieselmotor mit ordentlicher Abgasreinigung immer im Wirkungsgradoptimum Strom für den/die E-Motoren erzeugen. Für die paar Kilometer in der Stadt, auf kurzen Strecken, oder auf Firmengeländen wäre ein Akkubetrieb möglich. Durch die Rekuperation und den Betrieb bei 40% Wirkungsgrad des Diesels wären deutlich geringere Verbräuche möglich.
Aber da investiert man lieber Millionen in den Wasserstoffantrieb, an dem man seit 30 Jahren herumbastelt.
Jeru meint
„Aber da investiert man lieber Millionen in den Wasserstoffantrieb, an dem man seit 30 Jahren herumbastelt.“
Wozu diese Polemik?
Der FCEV Fanboy Peter W. würde wahrscheinlich schreiben:
„Aber da investiert man lieber Millionen in den Batterieantrieb, an dem man seit 120 Jahren herumbastelt.“
Aus meiner Sicht sind solche Vergleiche völlig daneben und bringen niemanden weiter.
Landmark M3 meint
Die Brennstoffzelle ist schon sehr alt 1838 Christian Friedrich Schönbein, 1968 ist sie zum Mond geflogen und 1969 gelandet.
Jeru meint
Natürlich kann man die Polemik immer weiter treiben und immer noch dämlicher Argumentieren.
So wurde die erste Batterie im Jahr 1800 von Volta erfunden, also vor 218 Jahren und die Batteriemobilität ist immer noch nicht alltagstauglich.
Diese Art der Diskussion halte ich für sehr unsinnig und bringt wie gesagt Niemanden weiter!
Fritz! meint
Was hat es denn mit Polemik zu tun, wenn jemand die Wahrheit sagt? Nur weil sie Ihnen nicht gefällt?
Es gibt eine sinnvolle Anwendung für Brennstoffzelle, das sind militärisch genutzte U-Boote.
Jeru meint
Polemik und „Wahrheit“ wiederspricht sich doch nicht?!
Und ich habe doch auf die völlig unsinnigen Fakten, mit anderen unsinnigen Fakten geantwortet?!
Wir halten also fest, an der Batterie wird schon seit 218 Jahren herumgedoktert, um bei den Worten von Peter W. zu bleiben.
Halten Sie diesen Vergleich für sinnvoll? Ich nicht.
Warum also mit solchen Angaben um die Ecke kommen, das hat doch mit der Sache überhaupt nichts zu tun und dient nur der Eskalation. Polemik eben.
one.second meint
Genau das habe ich auch gedacht. Und dazu zeigt Tesla ja, dass es auch ohne REx geht. Ich hoffe und drücke die Daumen, dass sie ihren Tesla-Semi bald liefern können, dann ist Daimler einfach nicht mehr konkurrenzfähig und es hat sich ausgedieselt.
Fritz! meint
2019 soll er kommen. Wahrscheinlich Ende 2019.
H2O3 meint
???
2-3 Liter Diesel?
3l Diesel haben ganz grob 30KWh Energiegehalt! Wie sollen denn da 100KWh Strom herauskommen, die 40-Tonner mindest pro 100Km benötigt??
Wenn man die ganzen thermischen und elektrischen Verluste berücksichtigt würde dieser Rex mindestens 25 Liter benötigen
Leonardo meint
Ich denke er meint 2-3 Liter Hubraum.