MAN Truck & Bus sieht sich beim Ausbau der Elektromobilität gut aufgestellt. Bereits seit dem ersten Halbjahr laufen Vorserienmodelle der E-Lkw bei Kunden im Praxisbetrieb, im Juni 2025 startete die Serienproduktion. CEO Alexander Vlaskamp betont im Gespräch mit Business Insider, dass die Volkswagen-Tochter in den vergangenen sechs Monaten der am schnellsten wachsende Hersteller schwerer E-Lkw in Europa gewesen sei – über 700 Bestellungen liegen bereits vor.
Trotz dieses Fortschritts bleibt die Ladeinfrastruktur ein Engpass. Vlaskamp kritisiert, dass Netzbetreiber nicht schnell genug Ladeanschlüsse mit drei Megawatt Leistung in Speditionsdepots installieren. Obwohl das Fahrzeugportfolio von klassischen Lkw bis hin zu E-Müllwagen bereit sei, fehle es Kunden an Planungssicherheit.
Um elektrische Lkw wirtschaftlich attraktiv zu machen, fordert der Manager politische Maßnahmen. Die geplante Mautbefreiung für Elektro-Lkw bis 2031 müsse zügig umgesetzt werden. Gemeinsam mit Subventionen und der ab 2027 steigenden CO₂-Abgabe auf Diesel könne sich ein E-Lkw dann im Vergleich zum Verbrenner bereits nach zweieinhalb bis drei Jahren amortisieren. Zusätzlich schlägt MAN vor, die Hälfte der Mauteinnahmen – rund sieben Milliarden Euro jährlich – in Ladeinfrastruktur und Förderprogramme zu investieren, um vor allem Mittelständler zu entlasten.
Ein weiterer Hebel zur Förderung der Elektromobilität ist laut MAN die Senkung der Strompreise. Vlaskamp fordert einen Industriestrompreis für die Logistikbranche und schlägt vor, die Kosten pro Kilowattstunde an E-Tankstellen auf 20 bis 30 Cent zu senken – derzeit lägen sie bei 45 bis 50 Cent. „Schließlich transportieren wir die Güter nur, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.“
Auch im Bereich autonomer Fahrtechnologien sieht sich MAN als Vorreiter. Das Unternehmen investiert seit Jahren in entsprechende Entwicklungen. Dennoch behindern finanzielle Rückstellungen zur Einhaltung der EU-CO₂-Vorgaben die Skalierung. „Für die Skalierung brauchen wir allerdings mehr Investitionskapazitäten“, warnt Vlaskamp. Er ist für eine koordinierte europäische Strategie, um technologische Abhängigkeiten zu vermeiden. Eine breite Einführung autonomer Lkw auf Autobahnen sei innerhalb von drei bis fünf Jahren realistisch – sofern geeignete Rahmenbedingungen geschaffen würden.
Schon erfolgreich mit E-Bussen
Im Bussegment ist MAN bereits international erfolgreich. Über 2.500 vollelektrische Stadtbusse sind europaweit im Einsatz und haben gemeinsam mehr als 100 Millionen Kilometer zurückgelegt. Laut Vlaskamp ein Beweis für die Marktreife: „Vor allem in Südeuropa gewinnen wir sogar Marktanteile mit E-Bussen – und holen den ein oder anderen Kunden von den Chinesen zurück.“ Die Stärke von MAN liege hier nicht nur in der Technik, sondern auch in einer etablierten Service-Infrastruktur.
Trotz starker Konkurrenz will MAN seine Marktposition weiter ausbauen. Die erreichte Marktführerschaft sei das Ergebnis jahrelanger Entwicklung, praktischer Erfahrung und enger Partnerschaften mit öffentlichen Verkehrsbetrieben, so der CEO. Wirtschaftlich sieht sich das Unternehmen stabil aufgestellt. In den kommenden Jahren will man über eine Milliarde Euro in Deutschland investieren – unter anderem in die Weiterbildung der Belegschaft für Elektro- und autonomes Fahren.
Neben der Batterieelektrik verfolgt MAN alternative Technologien. Im Fokus steht dabei der Wasserstoffverbrennungsmotor – kein Massenprodukt für Europa, sondern eine Lösung für Regionen mit speziellen Bedingungen. Die Technologie basiert auf bestehenden Motorenplattformen wie Methangas- und Dieselantriebe. MAN arbeitet dabei eng mit deutschen Zulieferern wie Mahle, Bosch und Voith zusammen. „Ich könnte natürlich kurzfristig Geld sparen, wenn ich das stoppen würde – aber zulasten unserer Zukunftsfähigkeit“, erklärt Vlaskamp.
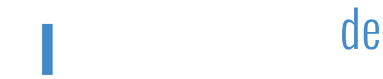

Frank meint
Ich könnte mir vorstellen, dass sehr große Speditionsunternehmen ihre eigenen Megacharger (mit eigenem Solarfeld, windrad und Pufferbatterie) an strategisch günstigen Stellen aufbauen um den Strompreis zu drücken. Natürlich lassen die dann auch andere (vor allem in Wind und Sonnenreichen Zeiten) gegen einen normalen Obulus laden.
Sebastian meint
Speditionen rechnen mit der zweiten Kommastelle! Wenn die nach und nach umsteigen, dann hat das seine (berechtigten) Gründe. Im Gegensatz zu Privatpersonen müssen solche Entscheidungen aber genauer getroffen werden, auch hinsichtlich Infrastruktur am Grundstück, bzw. die Planungen auf Tour – sofern es Touren sind die über mehrere Tage gehen. Trafo und HPCs für 7 stellige Beträge holt man nicht so einfach mal eben raus.
Der oft zitierte Elektrotrucker macht das super, auch weil er wie viele von uns Elektro Nerd ist. In den Videos zeigen sich aber auch die enormen Schwachstellen, die aktuell noch überall vorhanden sind. Wenn sogar bei Milence die Grundstücke so erbärmlich eng gebaut wurden, daß selbst Profis mehrmals umsetzen müssen… Absatteln des Anhängers mag sportlich erscheinen und am Anfang noch positiv einzuschätzen sein, auf Dauer geht so ein Quark natürlich überhaupt nicht. Ebenso an Ionitys zu laden, die eigentlich für PKWs sind. Was wenn zwei, drei andere Elektrotrucker das selbe machen?
Das ganze muss da um Längen besser werden, auch hinsichtlich auf Kastenwagen, Pickups mit Anhänger etc.
Um die Schleife zum Artikel wieder zu bekommen, mag ja ok sein, wenn sich die Technik nach 2 oder 3 Jahren rechnet, aber die Abläufe müssen im ALLTAG passen.
CaptainPicard meint
Was ich beim Elektrotrucker gesehen hab scheint der MAN LKW recht gut zu sein, aber der Mercedes fast in allen Bereichen noch einen Tick besser. Mehr Leistung hat er auch und während MAN noch auf NCM setzt hat Mercedes schon LFP Zellen und dürften somit preislich mehr Spielraum haben als MAN.
M. meint
MAN ist viel breiter aufgestellt, die liefern den mit quasi jedem Aufbau. Die können die Akkus auch besser skalieren bei gleichen Technologie – einfach mehr Module.
Der eActros ist in gewissen Bereichen aktuell schwer zu schlagen, aber so variabel wie bei MAN ist man nicht.
simon meint
Am besten wäre es wenn die Hersteller beides im Angebot hätten. Weniger flexible, aber reichweitenstarke LKWs mit wenigen großen Batterien (eActros 600) und modularere LKWs mit mehreren kleinen Akkus (eTGX). Ich weiß auch noch nicht genau welches Konzept ich besser finde.
Ich finde das LKW/Bus und PKW mit der Elektromobilität in Zukunft wieder enger zusammenwächst. ZB BYD verbaut in den neuen Stadtbussen flache Batterien im Unterboden, wenn man da 800V Autobatterien verbauen könnte wäre das ein Gamechanger. Auch weniger Steuergeräte und OTA Updates wie im PKW ist im Truck längst überfällig. Warum MAN und Scania da nicht das VW Infotainment verbauen (muss) ist mir ein Rätsel. Ähnlich eActros 600 und MBUX. Der LKW Markt ist paar Jahre zurück, aber gefühlt schaut keiner welche Fehler bei den PKW BEVs gemacht wurde.
Gunnar meint
Amortisation nach 2,5-3 Jahren. Das ist ein Nobrainer. Selbst wenn es 5-6 Jahre sein sollten, ist das immer noch wahnsinnig lukrativ. Die LKWs laufen ja eher 10-20 Jahre.
Jeder Spediteur, der rechnen kann und den höheren Invest für einen eLKW stemmen kann, ist quasi aus ökonomischen Gründen gezwungen, das zu tun. Alles andere wäre fahrlässig.
Mäx meint
LKW laufen eher 10 Jahre oder etwas weniger.
100-120k km im Jahr.
Mit 800k – 1 Mio. km werden die meistens spätestens abgestoßen.
Investitionen, gerade mit höherem Investitionsaufwand werden gerne mit 24 Monaten Amortisationszeit gesehen.
Wenn man da jetzt nahe dran liegt, wäre das aber in der Tat sehr gut!
Wir haben interne LKW am Laufen, die aber weniger Kilometerleistung im Jahr haben.
Da wird es mit der Amortisation knapp. Vielleicht fällt irgendwann mal ein guter günstiger Gebrauchter ab.
M. meint
Lt. Finanzamt sind die in 9 Jahren abzuschreiben.
Dann ist es halt eine Frage, ob das Geschäft es aktuell hergibt, das nächste, neue und modernere Fahrzeug abzuschreiben oder nicht.
Wenn ja, ist der alte weg.
Jörg2 meint
Es gibt kein Verbot, über einen längeren Zeitraum abzuschreiben.
Genauso gibt es (wenn begründbar) die Möglichkeit, kürzer, als die AfA-Tabelle es vorsieht, abzuschreiben.
Mit „linear“ und „degressiv“ will ich die Leserschaft mal nicht langweilen.
Auch hat „Abschreibung“ nur sehr begrenzt etwas mit Liquidität für neues Invest zu tun. Es ist ein Mittel der Steuereinnahmeglättung des Staates.
M. meint
Die 9 Jahre nennt Fleethouse, so stünde es in der AfA-Tabelle.
Vielleicht hast du aber Lust, eine seitenlange Abhandlung dazu zu schreiben, warum es nicht so ist.
Mir ist es egal, ich werde es auch nicht lesen.
Jörg2 meint
M
Quelle ist das Bundesministerium für Finanzen.
Nein, Du musst nicht dazulernen wollen. Und ja, Du darfst angepisst sein, wann immer Du willst.
M. meint
AfA-Tabelle des BMF habe ich aber schon genannt, oder?
Verlinke doch mal was.
Jörg2 meint
M
Mir ging es darum, dass Du den richtigen 9-Jahreswert der AfA-Tabelle als Grundlage für kaufmännische Entscheidung für Aus- und Einflottungen als gesetzt heranziehst.
Die Regelungen zur Abschreibung sind da (manchmal erst in Absprache mit dem FiAmt) viel fexibler.
Als Grundlage dafür, ob und wann neue Fahrzeuge in die Flotte kommen, alte rausgehen, spielt die Abschreibung eine sehr untergeordnete Rolle.
Die deutsche Steuergesetzgebung, inkl. der Abschreibungsregelungen, ist frei zugänglich.
Am Rande: Manchmal reicht eine Google-Kurzsuche nicht aus, um bisdahin unbekannte Themen vollumfänglich zu erfassen. Das ist nicht schlimm. Man sollte es nur immer mal wieder bedenken.
M. meint
Das habe ich gar nicht getan, ich dachte, das wäre klar.
Das Thema tangiert mich leider viel zu wenig, als dass ich deswegen ein halbes Studium absolvieren würde.
Aber dass du mir eine Google!!!-Suche unterstellst, verletzt mich.
Wir kennen uns nicht gut, aber das könntest du besser wissen. ;-)