Mercedes‑Benz arbeitet an neuen Ladelösungen für zu Hause, den Arbeitsplatz und den öffentlichen Raum. Mit dem Experimentalfahrzeug „Elf“ zeigen die Stuttgarter ein rollendes Labor für ultraschnelles, bidirektionales, solares, induktives und konduktives Laden in einem ganzheitlichen Konzept. Damit wolle man die Grenzen des Machbaren nicht nur testen, sondern neu definieren, heißt es.

„Schnellladen: An der Grenze des Machbaren“
Schnellladen sei der Schlüssel für die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität, so Mercedes. Mit dem Experimentalfahrzeug ELF erforsche man die Grenzen des technisch Machbaren – sowohl im Fahrzeug als auch an der Ladesäule. Dafür sei das Experimentalfahrzeug mit zwei Schnellladesystemen ausgestattet, die unterschiedliche Anwendungsfelder abdecken.
- MCS-Stecker (Megawatt Charging System): Ursprünglich für den Schwerlastverkehr entwickelt, erlaubt dieses System Ladeleistungen im Megawattbereich. Im ELF dient MCS als Forschungswerkzeug, um die thermische Belastbarkeit und Leistungsgrenzen von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik, Ladekabel und weiteren Komponenten unter Extrembedingungen zu testen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Entwicklung von Langstreckenfahrzeugen und Flottenlösungen mit kurzen Standzeiten einfließen
- CCS-Stecker (Combined Charging System): Als Standard für Pkw kommt CCS zum Einsatz, um seriennahe Komponenten wie Kabel, Stecker, Kühlung und Ladesteuerung unter Alltagsbedingungen zu erproben. Mercedes‑Benz testet die technischen Grenzen von CCS aus, um die Voraussetzungen für noch höhere Ladeleistungen zu schaffen. Im ELF sind bis zu 900 kW Ladeleistung möglich. Damit können 100 kWh in zehn Minuten geladen werden. Das Fahrzeug simuliert typische Ladeszenarien, wie sie auch im Kundenalltag auftreten, etwa an Schnellladestationen entlang von Autobahnen oder im urbanen Raum. Die eingesetzten Komponenten wie Batterie, Ladesteuerung und CCS-Hardware sind laut Mercedes seriennahe Entwicklungen und sollen perspektivisch in kommende Modelle einfließen.
Mit der Kombination aus MCS und CCS verfolge man einen doppelten Forschungsansatz, erklärt das Unternehmen. „Einerseits werden neue technologische Horizonte ausgelotet und die Technologie der Zukunft entwickelt. Andererseits wird die Serienreife bestehender Systeme und somit das Ladeerlebnis von heute verbessert.“
Der Autohersteller hat gemeinsam mit Alpitronic für die Rekordfahrt des Concept AMG GT XX den Prototypen einer Hochleistungs-Ladesäule entwickelt. Sie kann erstmals über ein CCS-Kabel Ströme von bis zu 1.000 Ampere übertragen – doppelt so viel wie bisher üblich. Die Erkenntnisse aus der Prototypen-Ladesäule sollen direkt in die Entwicklung einer neuen Generation von High-Performance-Schnellladern einfließen, die an Mercedes‑Ladeparks zum Einsatz kommen.
Bidirektionales Laden: Energie zurückgeben
Mit dem ELF erforscht Mercedes auch das Potenzial des bidirektionalen Ladens. Damit lässt sich Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch ins Haus (Vehicle-to-Home, V2H), ins Netz (Vehicle-to-Grid, V2G) oder direkt an elektrische Geräte (Vehicle-to-Load, V2L) abgeben. Damit können E-Autos zum aktiven Bestandteil eines nachhaltigen Energiesystems werden. Künftig sollen sie Kunden von Mercedes mehr Unabhängigkeit ermöglichen sowie Potenzial zur Kosteneinsparung bieten. Der ELF testet bidirektionales Laden in realen Szenarien. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen den Angaben nach direkt in die Serienentwicklung kommender Modelle ein.
Das ELF ist sowohl AC- als auch DC-bidirektional ladefähig
AC (Wechselstrom) ermöglicht die Stromversorgung elektrischer Geräte (V2L) sowie die Rückspeisung über eine bidirektionale AC-Wallbox direkt ins Hausnetz – für Anwendungen wie Vehicle-to-Home (V2H), Vehicle-to-Building (V2B) oder ins öffentliche Stromnetz (V2G). Der Vorteil: Die Infrastruktur ist kostengünstiger. Der Nachteil: Die Standardisierung wird komplexer, da das Fahrzeug die Anforderungen verschiedener Stromnetze erfüllen muss.
DC (Gleichstrom) erlaubt eine direkte Rückspeisung mit einer bidirektionalen DC-Wallbox ins öffentliche Stromnetz (V2G) und direkt ins Haus- oder Gebäudenetz (V2H, V2B), je nach eingesetzter Infrastruktur. Der Vorteil: Hohe Effizienz insbesondere bei Einsatz eines Hybrid-Wechselrichters gemeinsam für bidirektionales Laden. Mit Photovoltaik und Heimspeicher, einfachere Erfüllung der Netzanforderungen. Ein möglicher Nachteil könnten die etwas höheren Investitionskosten für die Ladeinfrastruktur sein.
„Mercedes-Benz bringt hier nicht nur Forschung, sondern auch Erfahrung ein, wie durch die erfolgreiche Einführung bidirektionalen Ladens in Japan mit dem CHAdeMO-Standard“, so das Unternehmen. Auch für den CCS-Standard bereite man konkrete Kundenangebote vor. Der neue vollelektrische CLA mit EQ Technologie und der neue GLC mit EQ Technologie seien schon technisch für bidirektionales Laden mit einer kompatiblen Gleichstrom-(DC)-Wallbox vorbereitet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Im Laufe des kommenden Jahres will Mercedes‑Benz erste Services für bidirektionales Laden in Deutschland, Frankreich und Großbritannien starten. Weitere Märkte sollen folgen. „Das Angebot MB.CHARGE Home kombiniert Fahrzeug, bidirektionale Wallbox, Ökostromtarif und Energiemarktzugang. Ziel ist es, Haushaltskosten zu senken und die Netzstabilität zu unterstützen“, so die Schwaben. „Über intelligente Steuerung und eine App können Fahrzeuge nicht nur kostenoptimiert laden, sondern auch Energie ins Hausnetz oder Stromnetz zurückspeisen. Damit werden Elektroautos zu aktiven Energiespeichern und leisten einen Beitrag zur Energiewende.“
Induktives Laden: Kabellos in die Zukunft
Mit dem ELF erprobt Mercedes darüber hinaus das Laden ohne Kabel per Induktion. Dabei wird elektrische Energie über ein im Boden integriertes Ladesystem kontaktlos auf das Fahrzeug übertragen. Diese Technologie bietet nach Ansicht des Unternehmens besonders zu Hause und für Flottenanwendungen großes Potenzial, da sie das Laden komfortabler und nahezu unsichtbar mache.
Das ELF ist mit einem induktiven Ladesystem ausgestattet, das auf dem Prinzip der magnetischen Resonanz basiert. Die Ladeleistung liegt aktuell bei 11 kW Wechselstrom (AC), was einer typischen Wallbox entspricht. Die Technologie wird im Rahmen des Projekts auf Alltagstauglichkeit, Wirkungsgrad und Kompatibilität mit verschiedenen Fahrzeughöhen und -positionierungen getestet für unterschiedliche Mobilitätskonzepte wie Premiumfahrzeuge, Robotaxi-Ansätze oder Flottenlösungen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzerfreundlichkeit und internationalen Skalierbarkeit.
Konduktives Laden: Für eine effiziente Energieübertragung
Das automatisierte konduktive Laden über den Fahrzeugboden stellt laut Mercedes eine innovative Methode dar, um Elektrofahrzeuge komfortabel und effizient zu laden. Beim konduktiven Laden werden spezielle Ladeplatten im Boden genutzt, die mit dem Fahrzeug kommunizieren. Sie helfen dem Fahrer oder dem „Park Assist“ das Fahrzeug korrekt einzuparken und den Ladevorgang zu initiieren. Die Energieübertragung erfolgt durch eine direkte physische Verbindung über einen sogenannten Connector im Fahrzeugboden. Die Ladeleistung liegt aktuell bei 11 kW AC.
Besonderes Augenmerk beim ELF liegt auf der Installation des Connectors im Fahrzeugboden und den Positionierungsanforderungen: Das Fahrzeug muss in einem bestimmten Bereich über der Ladeplatte positioniert werden, um den Ladevorgang zu starten, was zielgerichtetes Parken erfordert.
Gerade für barrierefreie Anwendungen oder enge Parkräume ist das konduktive Laden nach Meinung von Mercedes besonders geeignet. Ein weiterer Vorteil sei die ästhetische Integration der Ladeinfrastruktur in den Boden, was zu einem aufgeräumten Erscheinungsbild führe und weniger Platz benötige als traditionelle Ladestationen. Hinzu komme: Der Wirkungsgrad entspricht dem von kabelgebundenen Systemen und ist etwas besser als bei induktiven Lösungen.
Automatisiertes Laden: Infrastruktur mit Robotik neu gedacht
Zusätzlich zur Steigerung der Ladeleistung rückt auch die Automatisierung des Ladevorgangs per Robotik zunehmend in den Fokus. Besonders im Bereich des Schnellladens, wo hohe Ströme und große Kabelquerschnitte eingesetzt werden, biete robotergestütztes Laden eine vielversprechende Lösung, meint Mercedes. Das Unternehmen erforscht deshalb automatisierte Ladesysteme, die es ermöglichen, Fahrzeuge präzise, sicher und ganz ohne manuelles Zutun mit der Ladeinfrastruktur zu verbinden.
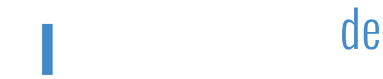

Timo meint
„physische Verbindung über einen sogenannten Connector“ – Stecker halt
paule meint
Nö. Ist eher eine Kontaktplatte. Mach Dich schlau und google nach Easelink.
hu.ms meint
Mir würden 20kw in 5 min = 240 kwh durchschnittliche ladeleistung reichen.
Sollte mit herkömmlichen CCS möglich sein.
Fred Feuerstein meint
Der Sozialpädagoge mit dem 5 phasigen Kabel bekommt nicht mal auseinander was kW und kWh bedeutet.
Jörg2 meint
hu.ms
Könntest Du Deine Rechnung kurz erläutern? Danke!
Ich lese da: 20kW mal 1/12h ergibt 240kWh.
Jörg2 meint
Nachtrag:
Ich vermute, Du willst irgendwie zum Ausdruck bringen, dass Dir 20kWh Nachlademenge innerhalb von 5 Minuten als Ladeleistung reichen würden.
Fred Feuerstein meint
Das kommt zu Stande weil humsi keine Ahnung von elektrischen Einheiten hat.
Mary Schmitt meint
Stimmt. Ne Ahnung hat er nicht. Aber mit gutem Willen, weiß man, was er sagen wollte. Und guten Willen habt ihr nicht!
Fred Feuerstein meint
Oh, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit, wie schön!
Jensen meint
Forschen, entwickeln und ausprobieren. Aussortieren, weiterentwickeln und weiter testen. So ist es gut und wichtig. Und in der Zwischenzeit werden sicher auch das eine oder andere Produkt oder Service für den Alltag entstehen. Wobei ich bei der Grundthese, dass Schnelladen der Schlüssel für die Alltagstauglichkeit ist, nicht ganz mitgehe.
Schnelladen ist ein nicht unwichtiger Teil des Ganzen, aber nicht „der“ Schlüssel.
Martin meint
Wenn man möchte kann man auch für jedes BEV extra ein schickes AC Kabel verbauen. Das ist auf jeden Fall alltagtauglich…
Bei der einen oder anderen Immobilien kostet so eine schnarchladesäule in der Tiefgarage dann eben 8.000 Euro je AC Anschluss. Kein Problem…
Im Leben gibt es ein gute Regel, machen was notwendig und das wichtigste zu erst – zu einem fairen Preis. Dann kommt man recht schnell auf das Produkt das sich am besten durchsetzen kann.
Martin meint
Und weiße Haare hat der user auch schon bekommen, weil die Ladekaap nicht funktioniert *ggg
Matthias meint
Tolles Ding, aber „neu gedacht“ wurde offenbar nicht alles. Warum die Ladeklappe auf Kniehöhe im vorderen Stoßstangeneck?
Martin meint
Das soll den demutsvollen Kniefall der heiligen Kuh (BEV) darstellen.
EQ-Fahrer meint
Der EQV hat eben dort die Ladeklappe. Schon immer. Ist super praktisch bei einem so langen Fahrzeug. Fahre seit 4,5 Jahren einen und auch zwischendurch immer wieder andere Fahrzeuge. Mit keinem kommt man so entspannt an die Ladesäule.
paule meint
Das ist barrierefrei, dafür gabs extra Förderung. An der Klappe sind auch entsprechend Pünktchen dran.